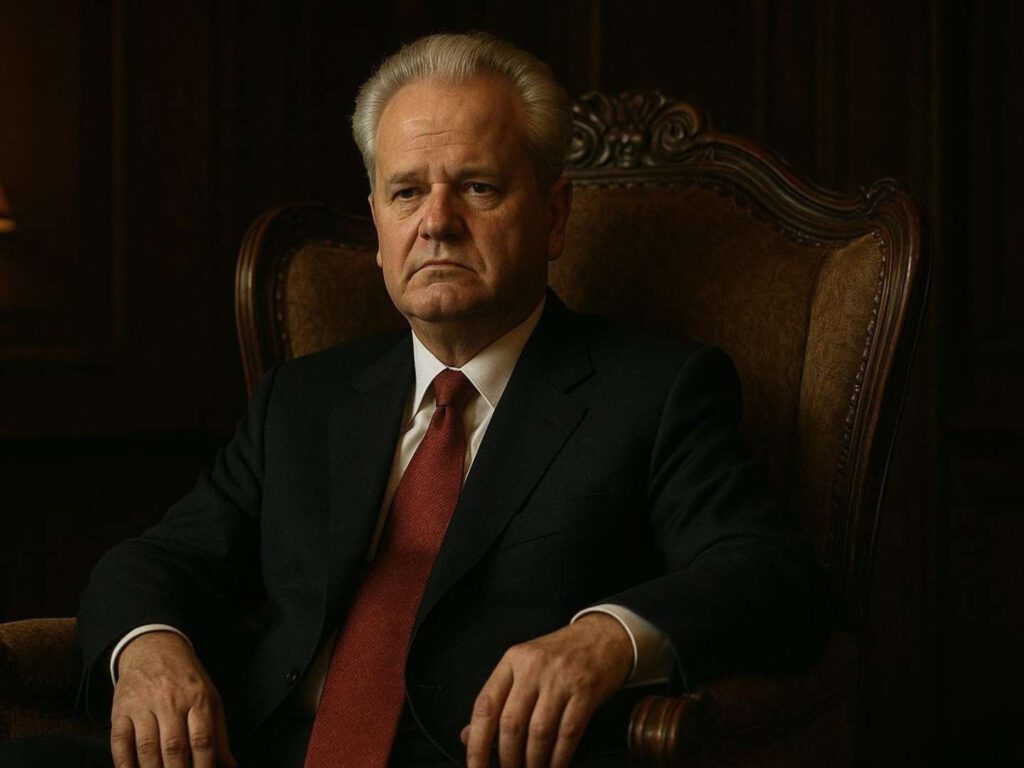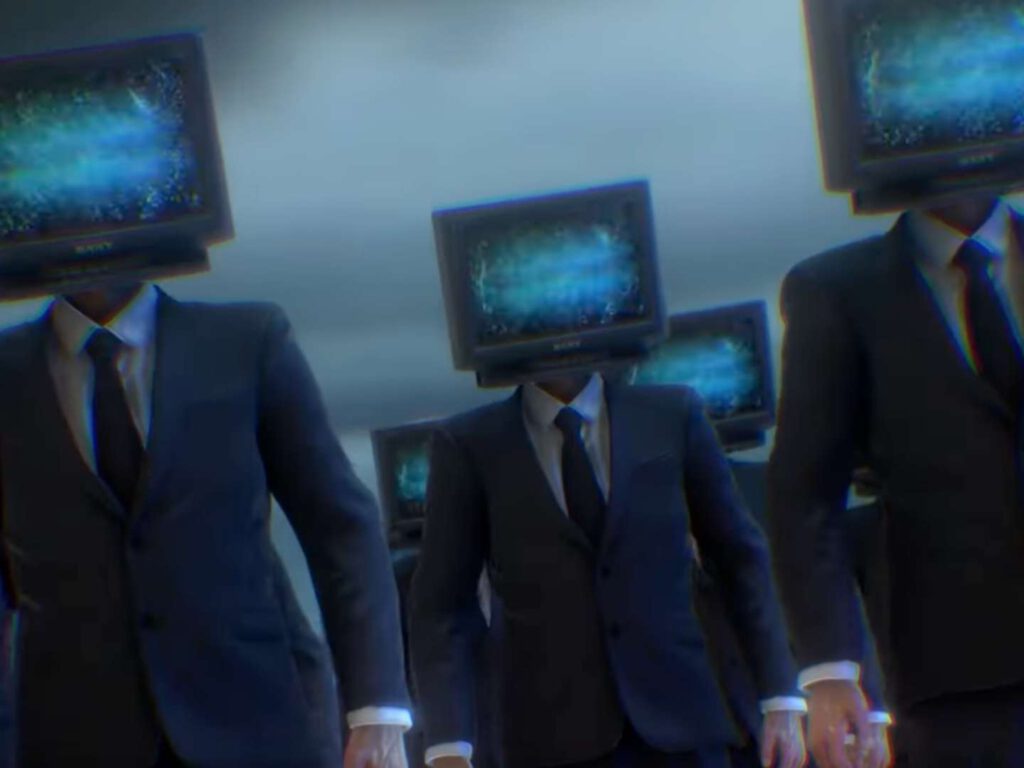Biodiversität in Gefahr: Was getan werden muss

Biodiversität ist selten ein Thema, das medial eine breite Aufmerksamkeit erfährt. Abgesehen von Öltankerunfällen und den damit einhergehenden schrecklichen Bildern bekommt die breite Öffentlichkeit selten vor Augen geführt, wie gravierend die Auswirkungen der Menschen auf Ökosysteme sein können und welche Folgen dies haben kann. Dabei geht es um weit mehr als den Erhalt der Flora und Fauna. Es geht um viel Geld, um innovative Entwicklungen und womöglich auch um den Fortbestand unserer Art.
Der neueste Bericht des Weltbiodiversitätsrats (IPBES) veranschaulicht, was Forscher:innen schon lange anmerken: Verschiedene Krisen und deren Lösungen sind miteinander verwoben. Es ist beispielsweise bekannt, dass Korallenriffe aufgrund der Erwärmung der Ozeane in Gefahr sind. Würde man allerdings das Aufheizen stoppen, wären sie immer noch von Überfischung und Verschmutzung betroffen. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass man einen gesamtheitlichen Ansatz braucht, wenn man das Artensterben aufhalten will – aufgrund der Verwobenheit der Krisen reicht ein isolierter Blick auf eine nicht aus. Bei der Präsentation des IPBES-Berichts Ende Jänner 2025 an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften wurden sowohl bestehende Probleme im Bereich Biodiversität wie auch Handlungsoptionen aufgezeigt.
Schutz von Biodiversität vs. Nichthandeln
Bei der Biodiversitäts-Thematik geht es um enorm viel Geld. Laut dem IPBES-Bericht fließen global jährlich etwa 200 Milliarden Dollar in die Verbesserung der Natur. Im Gegensatz dazu werden durch unsere Art zu wirtschaften, zu produzieren und zu konsumieren, etwa 7 Billionen Dollar – also das 35-Fache – in Aktivitäten investiert, die der Natur, der Biodiversität, der Wasserqualität, der Gesundheit oder auch der Ernährungssicherheit schaden. Außerdem sind die Auswirkungen der Umwelt- und Klimakrise sehr ungleich verteilt und betreffen vor allem jene Menschen, die in Entwicklungsländern leben. Noch mehr Zahlen: Die EU schätzt, dass weltweit zwischen 1997 und 2011 bereits Ökosystemdienstleistungen Ökosystemdienstleistungen sind beispielsweise die Bestäubung durch Bienen, die Reinigung von Luft durch Photosynthese, die Verfügbarkeit von Trinkwasser oder auch die Erholungsfunktion eines Walds. Es sind also Dienstleistungen, die von der Natur und von den Ökosystemen für uns Menschen ohne unser Zutun bereitgestellt werden. mit einem monetären Wert von 3,5 bis 18,5 Billionen Euro pro Jahr verloren gingen.
Die unbekannte Krise
Die Biodiversitätskrise ist wohl eine der unbekanntesten Krisen, aber ihre Auswirkungen sind riesig, denn Biodiversität ist die Voraussetzung für lebensnotwendige Bereiche wie Bodenfruchtbarkeit für die Lebensmittelproduktion, Schutz vor Naturgefahren, saubere Luft oder sauberes Wasser. Indirekte Treiber des Biodiversitätsverlusts sind laut IPBES-Bericht die wirtschaftlichen, technologischen und demografischen Veränderungen. Wie ist das zu verstehen? Ein kurzer Blick auf die Konsummuster gibt Aufschluss:
- In Deutschland werden Smartphones durchschnittlich nach 2,5 Jahren ersetzt, laut Greenpeace besitzt rund die Hälfte der deutschen Bevölkerung rund 50 bis 100 Kleidungsstücke, wobei die Produktion einer Jeans ca. 7.000 Liter Wasser verbraucht.
- In Österreich unternahmen 5,91 Millionen Menschen gesamt etwa 27 Millionen Urlaubsreisen, innerhalb Österreichs und ins Ausland.
- Im Jahr 1960 versorgte ein:e Landwirt:in im Schnitt zwölf Personen mit Nahrung, im Jahr 2020 waren es bereits 100 Personen. Dies gelingt unter anderem Dank des technologischen Fortschritts, wie dem Einsatz von Dünger, Pestiziden oder Herbiziden, die jedoch oft auf nicht nachhaltige Weise eingesetzt werden.
Man könnte diese Liste weiterführen mit Themen wie Flächenversiegelung, fossile Energieversorgung oder lineare Abfallwirtschaft: Verhaltensweisen, die unserer Natur deutlich zusetzen. Und das, obwohl laut IPBES-Bericht die Hälfte des globalen BIP – was rund 58 Billionen Dollar entspricht – von Sektoren generiert wird, die stark abhängig von der Natur sind.
Auch der Produktivitätsrat schreibt in seinem Bericht, dass die Biodiversität zurückgeht, obwohl ein Viertel der Flächen in Österreich biologisch bewirtschaftet werden. Außerdem entstehe hierzulande laut dem Bericht durch Bodenerosion und Flächenversiegelung ein erhöhtes Überschwemmungsrisiko – was uns im September 2024 in Niederösterreich schmerzlich vor Augen geführt wurde.
Hebel für Veränderungen und Stärkung der Biodiversität
„Raus aus den Silos“ und „integriertes Denken“ waren unter den wichtigsten Schlagworten bei der Präsentation des IPBES-Berichts an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Das sektorenübergreifende Bearbeiten scheint logisch, angesichts der Verwobenheit der diversen Krisen.
Einige Bereiche, wo dringend Veränderung nötig ist: Energiemix und -intensität, Flächenversiegelung, Transformation emissionsintensiver Sektoren (zum Beispiel Stahl- oder Zementindustrie), Kreislaufwirtschaft und Materialverbrauch, Förderung von Forschung und Innovation sowie Klimaneutralität als Asset des Wirtschaftsstandorts. Eine äußerst wichtige Botschaft aus dem IPBES-Bericht ist aber auch, den Fokus nicht nur auf Synergien zwischen diversen Bereichen zu legen, sondern auch die Trade-offs zwischen unterschiedlichen Zielen zu erkennen. Ein Trade-off im Bereich Energie könnte beispielsweise sein, das Ziel einer Energiekostensenkung und gleichzeitig der Bedarf, den Ausbau des Energienetzes aufgrund des hohen Anteils erneuerbarer Energieanlagen voranzutreiben, was wiederum Kosten für Nutzer:innen verursacht.
Der IPBES-Bericht stellt 71 Lösungsoptionen bzw. „Response Options“ für die Verbesserung der Biodiversität vor. Bei der Präsentation des Berichts in Wien wurde deutlich, dass es nicht die fünf wichtigsten und universellen Maßnahmen gibt, die man herausfiltern kann, da jeder Staat individuell und je nach Ausgangssituation entscheiden muss, welche „Response Options“ am wirkungsvollsten sind. Die Optionen reichen dabei von Renaturierung über Risikomanagement, Reduzierung der Verschmutzung über nachhaltige und gesunde Ernährung bis hin zu Subventionspolitik.
Stichwort Renaturierung: Hier hat Österreich mit der Erstellung des Wiederherstellungsplans im Zuge der Umsetzung des Renaturierungsgesetzes bis September 2026 Zeit, wirkungsvolle Maßnahmen für die Stärkung der biologischen Vielfalt zu setzen. Alice Vadrot, stellvertretende Obfrau der Kommission für Biodiversität in Österreich, sieht im Wiederherstellungsplan eine große Chance:
„Der Wiederherstellungsplan ist die Chance, endlich österreichweit Maßnahmen für den Erhalt, die Verbesserung und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt zu setzen – denn Biodiversität und Ökosysteme enden nicht an Landesgrenzen. Außerdem bietet sich die Möglichkeit, der Biodiversität eine prominentere Rolle im öffentlichen Diskurs zu geben, und Empfehlungen des Weltbiodiversitätsrats wie etwas aus dem Transformative Change Assessment, das einen Wertewandel fordert, umzusetzen.“