Das Ozonloch erholt sich – das Klima nicht
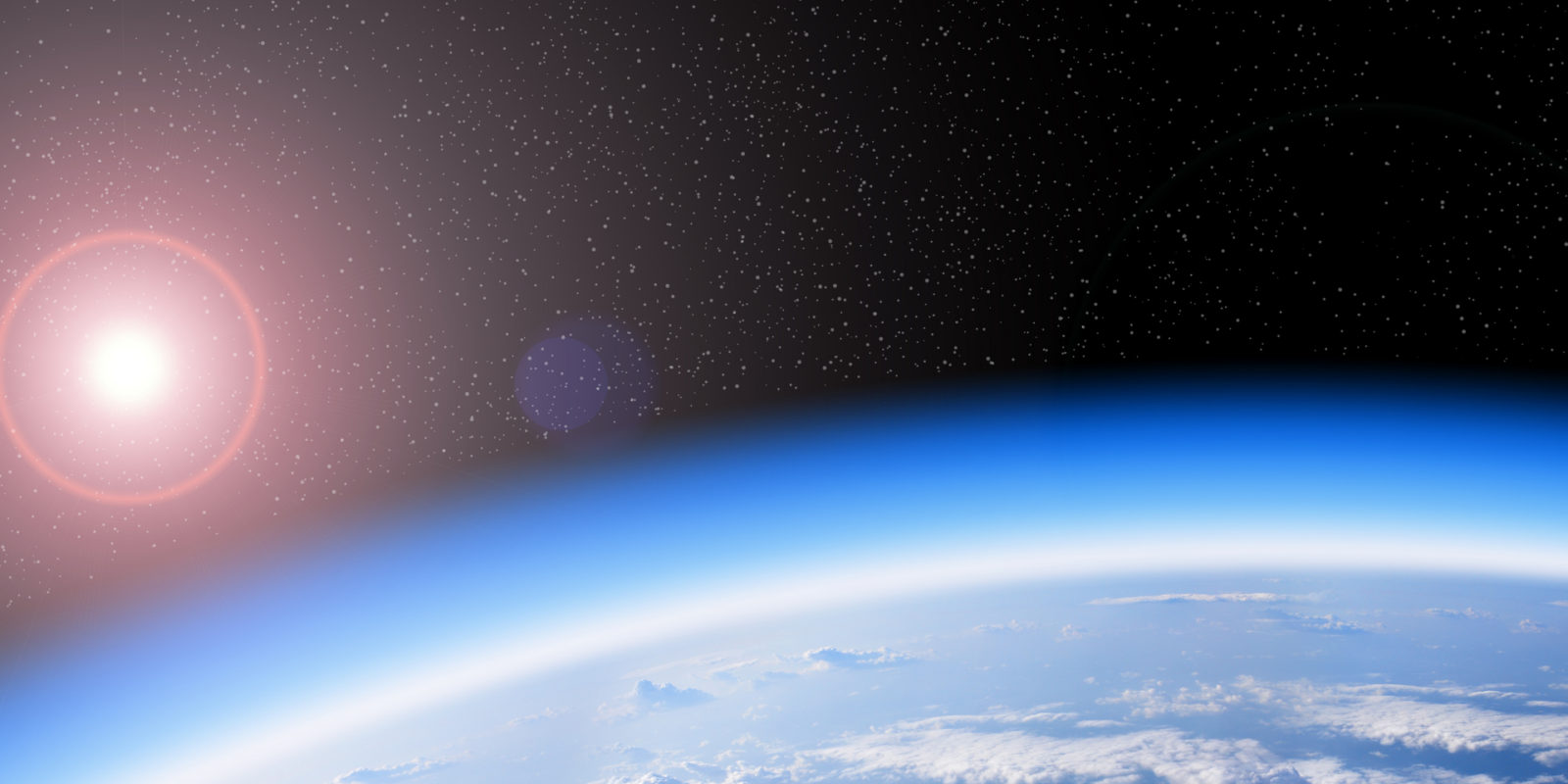
Es gibt sie noch, die guten Nachrichten vom Planeten Erde: Die Ozonschicht, seit Jahrzehnten von Chemikalien angegriffen und durchlöchert, erholt sich tatsächlich sehr gut. Dank Maßnahmen, auf die sich die Staatengemeinschaft (mittlerweile einstimmig) geeinigt hat. Eine Einigkeit, die in der Frage des Klimawandels schmerzlich vermisst wird.
„Hier haben einfach die Umweltinteressen tatsächlich nun einmal absolute Priorität gegenüber wirtschaftlichen Interessen – das muss auch jeder begreifen.“
Nein, das ist leider kein Zitat von der letzten UN-Klimakonferenz. Diese deutlichen Worte stammen vom ersten Umweltminister der Bundesrepublik Deutschland, Walter Wallmann, und sind im Jahr 1986 gefallen. Damals wusste man schon recht konkret über die Ausmaße des Ozonlochs Bescheid. Im Jahr zuvor war ein Artikel im Wissenschaftsmagazin Nature erschienen: „Starke Verluste des Gesamt-Ozons in der Antarktis“. Britische Forscher hatten über einen längeren Zeitraum Messdaten der Antarktisstation ausgewertet und schließlich ein riesiges Loch in der Ozonschicht entdeckt.
Nur zwei Jahre später, 1987, einigte sich die Staatengemeinschaft im Montreal-Protokoll auf das schrittweise Verbot von FCKW. Diese Fluorchlorkohlenwasserstoffe werden damals weltweit haufenweise eingesetzt: besonders als Kühlmittel in Kühlschränken oder als Treibmittel in Deo- oder Haarspraydosen sind sie beliebt, weil einfach und billig herstellbar. Dass die langlebigen, geruchlosen und unsichtbaren Gase verheerende Folgen für die Atmosphäre haben, entdeckten erstmals 1974 die beiden US-Forscher Mario Molina und Sherwood Roland. Von einem gefährlichen Ozonloch war da aber noch lange nicht die Rede, und die Warnungen der beiden Chemiker stießen zunächst auf wenig Gehör. Als Daten der NASA Anfang der 1980er Jahre erstmals auf die Durchlässigkeit der Ozonschicht hindeuteten, wurden diese schlicht als Messfehler abgetan. Dass dann 1985 das Erscheinen eines wissenschaftlichen Artikels ein regelrechtes Alarmsignal bedeutete, das noch dazu von der internationalen Politik gehört wurde – das kann man sich in der zusehends wissenschaftsfeindlichen Gegenwart nur schwer vorstellen.
Schutzschirm Ozonschicht
Das Problem war schnell erklärt: UV-Strahlen von der Sonne, die für den Menschen und die Natur gefährlich sind, werden von der Ozonschicht bis zu einem gewissen Grad herausgefiltert. Ist die Ozonschicht zu dünn, kann die ultraviolette Strahlung ungehindert auf die Erde treffen und sorgt für ein erhöhtes Hautkrebsrisiko, greift die Augen und das Immunsystem an, senkt aber auch die landwirtschaftliche Produktivität und schädigt die Ökosysteme.
Seit Beginn der 1980er Jahre tritt das Loch in der Ozonschicht jährlich auf. Wenn nach der langen, kalten Polarnacht über der Antarktis wieder die Sonne aufgeht, lösen die UV-Strahlen eine Kettenreaktion aus, bei der Chloratome (etwa von FCKW) Ozonmoleküle zerstören – die Ozonkonzentration sinkt, die Ozonschicht dünnt immer mehr aus und wird schließlich durchlässig für UV-Strahlung. Von einem „Loch“ in der Ozonschicht spricht man, wenn der Stratosphäre rund ein Drittel ihres sonst üblichen Ozonlevels verloren gegangen ist. Geht die Sonneneinstrahlung wieder zurück, bildet sich ausreichend neues Ozon, und das Ozonloch schließt sich wieder.
Fast 40 Jahre nach seiner Entdeckung fragt kaum noch jemand nach dem Ozonloch. Das Problem gilt als gelöst. Weil FCKW sehr langlebig sind und lange brauchen, bis sie in der Stratosphäre ankommen, wird es aber noch eine ganze Weile dauern, bis sich der UV-Schutzschirm der Erde vollständig erholt haben wird. Geht es im prognostizierten Tempo weiter, wird das über der Arktis im Jahr 2045 soweit sein, über der Antarktis 2066.
Meilenstein Montreal
Dass sich die Ozonschicht überhaupt erholt, ist dem schnellen Handeln der Politik zu verdanken. Allen voran US-Präsident Ronald Reagan und die britische Premierministerin Margaret Thatcher haben die Warnungen der Wissenschaft ernst genommen und die Weltgemeinschaft zusammengetrommelt. Am 16. September 1987 einigten sich knapp 40 Staaten darauf,
„geeignete Maßnahmen zu treffen, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor schädlichen Auswirkungen zu schützen, die durch menschliche Tätigkeiten, welche die Ozonschicht verändern, wahrscheinlich verändern, verursacht werden oder wahrscheinlich verursacht werden“.
Konkret beschloss man einen Fahrplan, um die Emission von chlor- und bromhaltigen Chemikalien, die Ozon in der Stratosphäre zerstören, schrittweise einzustellen: Produktion und Verbrauch von acht wichtigen FCKW und Halogenkohlenwasserstoffen sollten bis zum Jahr 1999 auf die Hälfte der Menge von 1986 reduziert werden.
Dass dies gelungen ist, ist bemerkenswert. Denn wie man in der oben zitierten Präambel sieht, hat es zu Beginn der Verhandlungen viele „Wahrscheinlichkeiten“ gegeben: sowohl die genauen Auswirkungen verschiedener Stoffe auf die Umwelt als auch das Ausmaß der Kosten, um diese einzudämmen, waren völlig unklar.
Das Montreal-Protokoll behandelte also ein umweltbezogenes Problem, das bis dahin nur theoretisch bestand: Im Labor und in Studien wurde die Wirkung von FCKW auf die Ozonschicht beschrieben, doch die tatsächliche Ausdehnung des Ozonlochs, und wichtiger, einen unmittelbar daraus resultierenden Schaden für die Umwelt oder den Menschen hatte man bis dahin nicht beobachten können. Eine auf dem Vorsorgeprinzip beruhende Vereinbarung von solch globalem Ausmaß hatte es zuvor nicht gegeben.
Weltweite Zustimmung
Schnell stellte sich jedoch heraus, dass die vereinbarten Maßnahmen nicht ausreichend waren; das erste Abkommen enthielt Ausnahmeregelungen und Übergangsfristen, die der Industrie zu große Spielräume ließen. Das war dem Widerstand der Hersteller der Chemikalien geschuldet: FCKW seien unverzichtbar und Ersatzstoffe nicht verfügbar, die Kühlschrankproduktion müsse ohne sie eingestellt werden. Dass es doch anders geht, hat vor allem Greenpeace zusammen mit einer kleinen ostdeutschen Firma gezeigt – und 1993 den ersten FCKW-freien Kühlschrank der Welt auf den Markt gebracht. Da dieser noch dazu unwesentlich teurer war als ein normaler Kühlschrank, hat es nicht lange gedauert, bis die großen Hersteller ebenfalls umschwenkten. Somit war auch der Produktions- und Verbrauchsstopp von FCKW bis zum Jahr 1996 auf Schiene, der bei der 4. Vertragsstaatenkonferenz im November 1992 in Kopenhagen als bedeutende Verschärfung beschlossen wurde.
Widerstand bildete sich aber auch in den Entwicklungsländern. Sie argumentierten, dass der übermäßige Gebrauch der Industriestaaten von FCKW zu einem guten Teil auch deren Wohlstand aufgebaut habe, und es den Entwicklungsländern nicht verwehrt werden könne, dasselbe zu tun. Für Entwicklungsländer galten daher großzügigere Fristen für die Umsetzung der Vertragsziele, zudem wurde 1990 ein multilateraler Fonds eingerichtet, der diese Länder durch eine solide Finanzierung unterstützen sollte.
Bei mehreren Nachfolgetreffen stieg die Zahl der Unterzeichnerstaaten stetig an, mittlerweile haben 197 Länder das Montrealer Protokoll unterschrieben. Es ist damit bis heute der einzige Vertrag der Vereinten Nationen, der von allen UN-Mitgliedstaaten ratifiziert wurde. Zudem gilt es nach wie vor als herausragendes Beispiel für den globalen Umweltschutz und als Meilenstein für das Umwelt-Völkerrecht.
Netter Nebeneffekt: Klimaschutz
Das Montreal-Protokoll war ursprünglich nicht darauf ausgerichtet, das Klima zu schützen. In erster Linie ging es darum, die gefährliche UV-Strahlung so gut wie möglich abzuwehren. Weil FCKW aber auch hochwirksame Treibhausgase sind, hat sich ihr Verbot positiv auf das Klima ausgewirkt: Wären die FCKW-Emissionen weiter so gestiegen wie bis zum Verbotsbeschluss Mitte der 1980er Jahre, hätten sie signifikant zur Erderwärmung beigetragen. Das Montreal-Protokoll hat mehr Treibhausgas-Emissionen verhindert als das Klimaschutzabkommen von Kyoto.
Und weil UV-Strahlung nicht nur für die menschliche Haut gefährlich ist, sondern auch Pflanzen schädigen und deren Photosynthese behindern kann, hat der Schutz der Ozonschicht auch einen positiven Effekt auf die Reduktion von CO2 in der Atmosphäre durch Pflanzen.
Eine der zahlreichen Erweiterungen des Montrealer Protokolls, das Kigali Amendment aus dem Jahr 2016, kontrolliert nun auch Substanzen, die von der Industrie als Alternative zu FCKW eingesetzt wurden, sich im Nachhinein aber als starke Treibhausgase erwiesen haben. Durch die geplante Reduzierung dieser teilhalogenierten Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW) kann die globale Erwärmung weiter eingedämmt werden.
Eine wissenschaftliche und umweltpolitische Erfolgsgeschichte
Und damit wären wir auch schon beim Thema Klimawandel und der Frage: Warum funktioniert das, was vor über 30 Jahren passiert ist, heute nicht mehr? Ist die Erderwärmung ein weniger schreckliches Szenario als das Ozonloch? Sind die Menschen weltweit wissenschaftsfeindlicher geworden? Sind Politiker:innen heute weniger entscheidungsfreudig, wenn es um Zukunftsthemen geht? Haben die wirtschaftlichen Interessen diesmal absolute Priorität gegenüber den Umweltinteressen?
Fairerweise muss man sagen: Das Ozonloch ist ein weitaus weniger komplexes Thema als der Klimawandel. Man konnte die Auslöser recht eindeutig identifizieren und diese dann auch vergleichsweise einfach durch unbedenkliche(re) Stoffe ersetzen. Ohne Ozonschicht und ihre schützende Wirkung wäre ein Leben auf der Erde, wie wir es kennen, überhaupt nicht mehr möglich, die UV-Strahlung würde uns förmlich rösten – das kann man jeder und jedem recht einfach erklären. Auch dass sich nach den FCKW-Verboten bald Erfolge eingestellt haben, war wichtig – dadurch sind Menschen eher zum Verzicht oder zu Verhaltensänderungen bereit.
Bei der Erderwärmung geht es in erster Linie um CO2 und um fossile Energie. Die kann im Gegensatz zu FCKW nur mit viel mehr Aufwand und Ressourcen ersetzt werden, daher ist der Widerstand der Wirtschaft (und der Bevölkerung) um ein Vielfaches größer.
Zeit für ein neues Montreal
Unsolidarische Abkommen oder halbherzige Zugeständnisse wie zuletzt bei der UN-Klimakonferenz bringen uns daher nicht weiter. Die Geschichte des Ozonlochs zeigt, dass in die Zukunft gerichtete Maßnahmen – mögen sie auch noch so schwierig umzusetzen sein – von der Bevölkerung akzeptiert werden, wenn die Staatengemeinschaft geschlossen dahintersteht. Und sie zeigt auch, dass die Umstellung auf Alternativen deutlich weniger aufwändig sein kann, als von vielen behauptet oder befürchtet wird. Die Bemühungen für die Ozonschicht sollten uns daher als Vorbild für klimaschonende Maßnahmen dienen. Bestrebungen der Industrie, umweltschonendere Technologien zu entwickeln, müssen intensiviert, von der Politik gefördert und gefordert werden.
Seit 1990 wird die Umsetzung des Montreal-Protokolls alle vier Jahre überprüft. Im letzten UN-Bericht dazu heißt es:
„Unser Erfolg beim Ausstieg aus ozonfressenden Chemikalien zeigt uns, was dringend getan werden kann und muss, um von fossilen Brennstoffen wegzukommen, Treibhausgase zu reduzieren und so den Temperaturanstieg zu begrenzen.“
Angesichts der deutlichen Warnungen des Weltklimarats vor einer Eskalation der Klimakrise ist es an der Zeit für ein neues Montreal.









