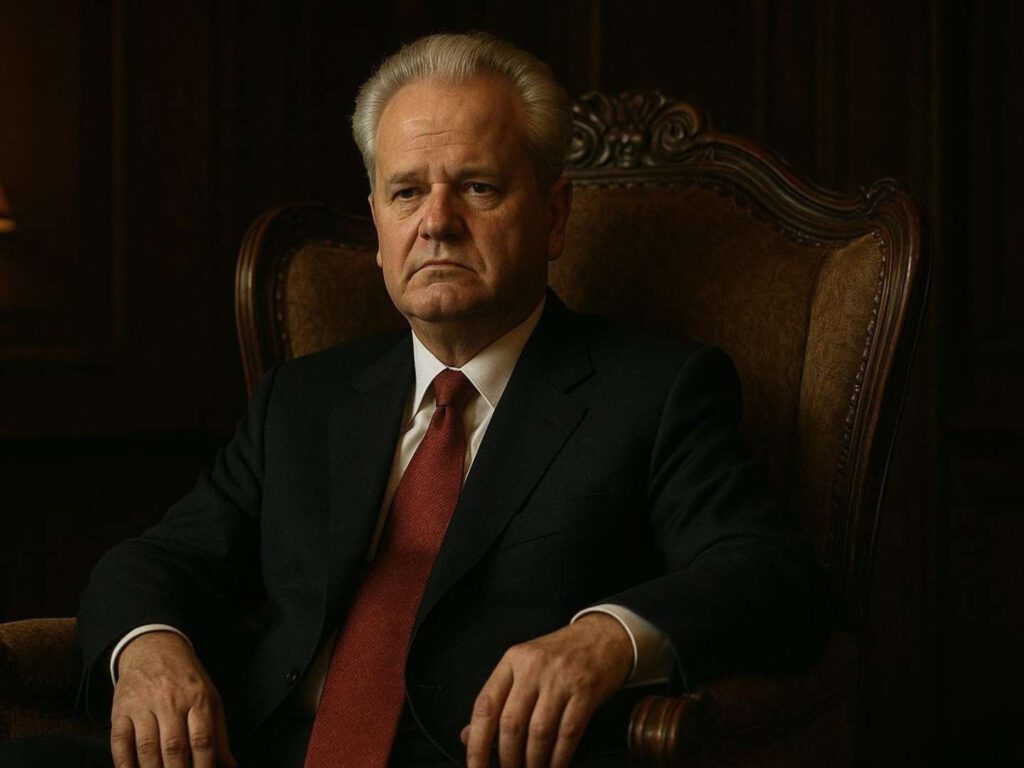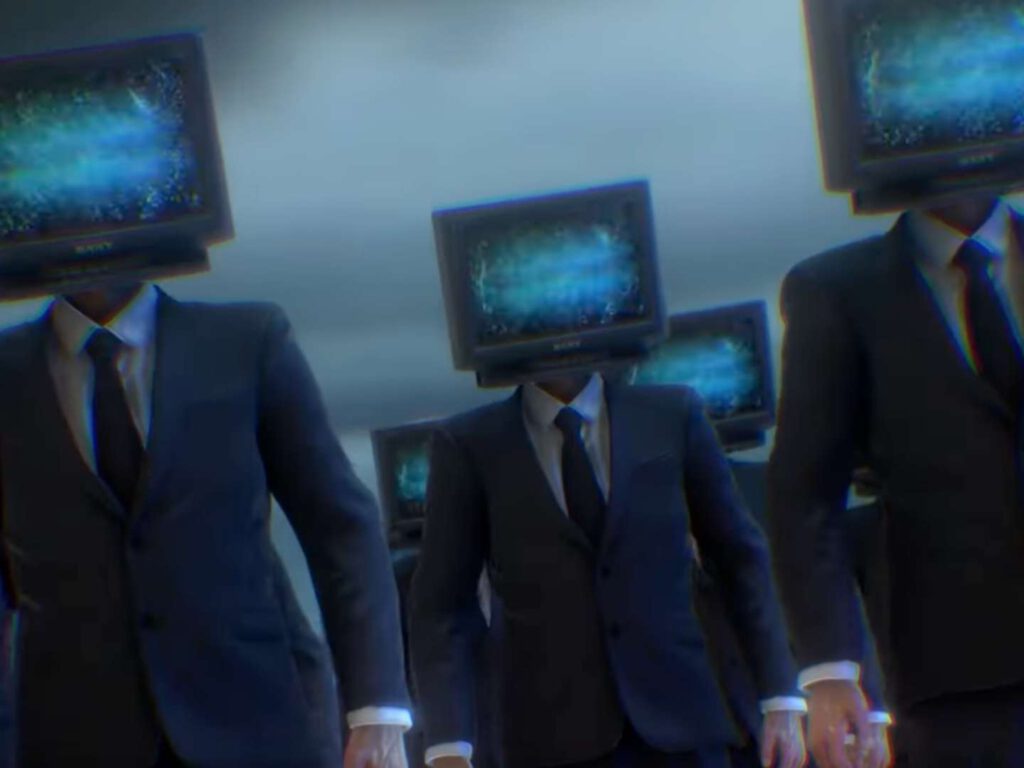„Koste es, was es wolle“ – Klimapolitik im Gebäudesektor

Zum vermutlich letzten Mal in ihrer Funktion als Klimaschutzministerin konnte Leonore Gewessler im Jänner 2025 die Veröffentlichung aktueller Daten über die Treibhausgasemissionen Österreichs zum Anlass nehmen, um die Wirksamkeit ihrer Klimapolitik hervorzustreichen und den Regierenden in spe mahnende Worte ob einer Abkehr des eingeschlagenen Weges mitzugeben:
„Nach jahrzehntelangem Stillstand haben wir Österreich auf Kurs gebracht zur Klimaneutralität bis 2040. Diesen guten Weg darf die nächste Regierung nicht verlassen, sonst zahlen unsere Kinder einen hohen Preis für die Klimazerstörung.“
Das Umweltbundesamt hatte Ende Jänner 2025 die Treibhausgas-Inventur für das Jahr 2023 veröffentlicht: Zum zweiten Mal in Folge wurden in Österreich mit 68,6 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent CO₂-Äquivalent ist die Maßeinheit zur Vergleichbarkeit der Klimawirkung von unterschiedlichen Treibhausgasen, ausgedrückt in jener von CO₂. deutlich weniger Kohlenstoffdioxid (CO₂) emittiert als im Jahr zuvor. Im Jahr 2019, vor der Angelobung der türkis-grünen Bundesregierung, waren es noch 80,5 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent. Und auch für 2024 deuten erste Berechnungen auf eine Prolongierung dieses Trends hin. Ein Sektor, der seit 2022 vor allem durch die Energiepreiskrise in Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine verstärkt im Fokus liegt, ist der Gebäudesektor. Es ist außerdem einer jener Bereiche, in denen die Regierung das Geld in Form von Förderungen mit beiden Händen verteilt hat.
Ambitionierter Zeithorizont
Die Zahlen des Umweltbundesamtes zeigen, dass mit 6,3 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent 9,2 Prozent der gesamten CO₂-Emissionen in Österreich alleine diesem Bereich zuzurechnen sind. Möchte man Klimaneutralität bis 2040 erreichen, müssen bis dahin alle Heizungen durch CO₂-freie Systeme ersetzt werden. Angaben über den Bestand von fossilen Heizsystemen aus dem Jahr 2023 durch das BMK verdeutlichen die Dimension der Aufgabe: Zum damaligen Zeitpunkt waren in Österreich noch 840.000 Gasheizungen, 500.000 Ölheizungen und 80.000 Heizungen mit Koks beziehungsweise Kohle in Betrieb.
Selbst wenn die kommende Bundesregierung den Plan der Wirtschaftskammer umsetzt und dieses Ziel auf 2050 verschiebt, gelten durch europäische Vorgaben ambitionierte Ziele: Die im Jahr 2024 in Kraft getretene Novelle der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden sieht vor, dass Mitgliedstaaten im Rahmen eines nationalen Gebäuderenovierungsplans Strategien und Maßnahmen zum Ausstieg aus mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizkesseln in der Wärme- und Kälteversorgung bis 2040 vorlegen. Es bleiben also 15 Jahre, um hunderttausende Heizungen mit fossilen Energieträgern durch klimafreundliche Systeme zu ersetzen. Dafür bedarf es neuer und kluger politischer Entscheidungen, denn die Strategie der schwarz-grünen Bundesregierung folgte auch in diesem Bereich dem Universalmotto „Koste es, was es wolle“, das die aktuelle Budgetmisere verursacht hat.
Nachdem die ÖVP auch angesichts hitziger Debatten zum umstrittenen Heizungsgesetz in Deutschland ihre Zustimmung zum im November 2022 im Ministerrat beschlossenen Erneuerbaren-Wärme-Gesetz zurückgezogen hatte, wurde dieses ein Jahr später in deutlich reduzierter Form doch noch beschlossen. Dabei wurde der geplante koordinierte gesetzlich vorgeschriebene Ausstieg aus allen Kohle- und Ölheizungen bis 2035 sowie aus Gasheizungen bis 2040 auf ein Einbauverbaut von fossilen Heizungen in Gebäudeneubauten reduziert. Um den Tausch von Heizsystemen in Bestandsgebäuden dennoch anzukurbeln, wurden die ohnehin gut gefüllten Fördertöpfe noch weiter aufgeblasen. Im Rahmen des Budgetbeschlusses 2024 wurde ein Zusagerahmen für die Umstellung auf klimafreundliche Heizsysteme sowie für thermische Sanierungen von Gebäuden in Höhe von 3,65 Milliarden Euro bis 2027 festgelegt.
„Großer Erfolg“ – für wen?
Um sicherzustellen, dass die zur Verfügung stehenden Geldmittel tatsächlich abgerufen werden, konnten seither 75 Prozent der technologiespezifischen Kosten der Umstellung auf klimafreundliche Heizsysteme sowie 50 Prozent der Kosten von thermischen Sanierungen gefördert werden.
Bereits ein Jahr später zeigt sich, dass die Fördertöpfe leer geräumt wurden. Obwohl für mehrere Jahre vorgesehen, waren bereits zum Ende des Jahres 2024 keine Mittel der knapp 4 Milliarden Euro mehr übrig, und die Förderungsaktion Sanierungsoffensive, über welche sowohl Heizungsumstellung als auch die thermische Gebäudesanierung abgewickelt wurde, wurde beendet. „Mit großem Erfolg„, wie das BMK schreibt. Eine enden wollend große Überraschung, könnte man entgegnen, wenn der Staat sich dafür entscheidet, mindestens drei Viertel der Kosten für den Heizungstausch zu übernehmen. Teilweise lag die Förderquote sogar noch höher, denn die 75 Prozent wurden als Mindestquote in Kombination mit Länderförderungen ausgelegt. In Tirol beispielsweise wurden bis zu 94 Prozent der Gesamtkosten einer umfassenden thermischen Sanierung inklusive Heizkesseltausch durch Förderungen übernommen, wie eine Global-2000-Analyse zeigt. Und obwohl hier gehandelt wurde, als hätte der Staat keine Budgetrestriktionen, kritisierte Global 2000 in derselben Analyse die Beschränkung der Fördertöpfe.
Der Rechnungshof hat jüngst empfohlen, in Zukunft „förder-, steuer- und ordnungspolitische Maßnahmen mit hoher Treibhausgas-Reduktionswirkung unter Kosten-Nutzen-Abwägungen zu priorisieren“. Eine langfristige Ausgestaltung von staatlichen Anreizprogrammen zum Umstieg auf klimafreundliche Heizungen wird sich an derartigen Abwägungen orientieren müssen. Für eine Optimierung des Programms sollte die Frage relevant sein, inwiefern Investitionen in den Heizungstausch und thermische Sanierungen nicht auch ohne die Förderung in der gesamten Höhe stattgefunden hätten. Eine Studie des Wegener Centers kommt beispielsweise zum Schluss, dass hauptsächlich die gestiegenen Energiepreise den Anstieg erneuerbarer Energieträger bei Heizsystemen erklären, auf die der Großteil des deutlichen Emissionsrückgangs im Gebäudesektor in den Jahren 2022 und 2023 zurückzuführen ist. In diesen Jahren wurde der Heizungstausch wohlgemerkt nicht mit einer Quote von 75 Prozent gefördert.
Wenn sich der Erfolg politischen Handelns daraus ableitet, schnell und umfassend Fördermittel an die Bevölkerung zu bringen, kann man zu dieser Vorgehensweise tatsächlich gratulieren. In der Realität steht die Republik am Ende der Regierungszeit von ÖVP und Grünen kurz vor einem EU-Defizitverfahren – die klimapolitischen Maßnahmen sollten daher dringend auf ihre ökonomische Vernunft evaluiert werden. Der eingeschlagene Weg der sinkenden Treibhausgasemissionen sollte dabei tatsächlich nicht verlassen werden. Bei der Wahl und Ausgestaltung der Instrumente ist jedoch eine Abkehr dringend geboten: zielgerichteter, differenzierter, effizienter und mit der Absicht der Vermeidung von Mitnahmeeffekten bei Förderungen. Sonst zahlen nicht nur unsere Kinder einen hohen Preis für die Klimazerstörung, sondern wir alle den Preis einer unnachhaltigen Budgetpolitik.