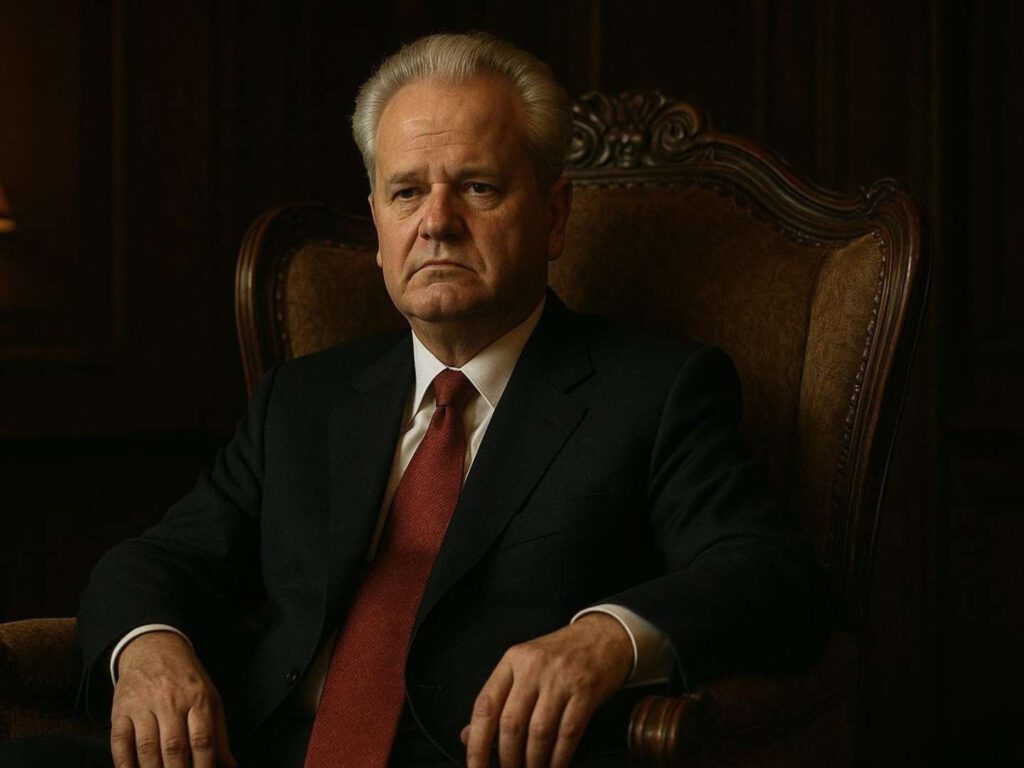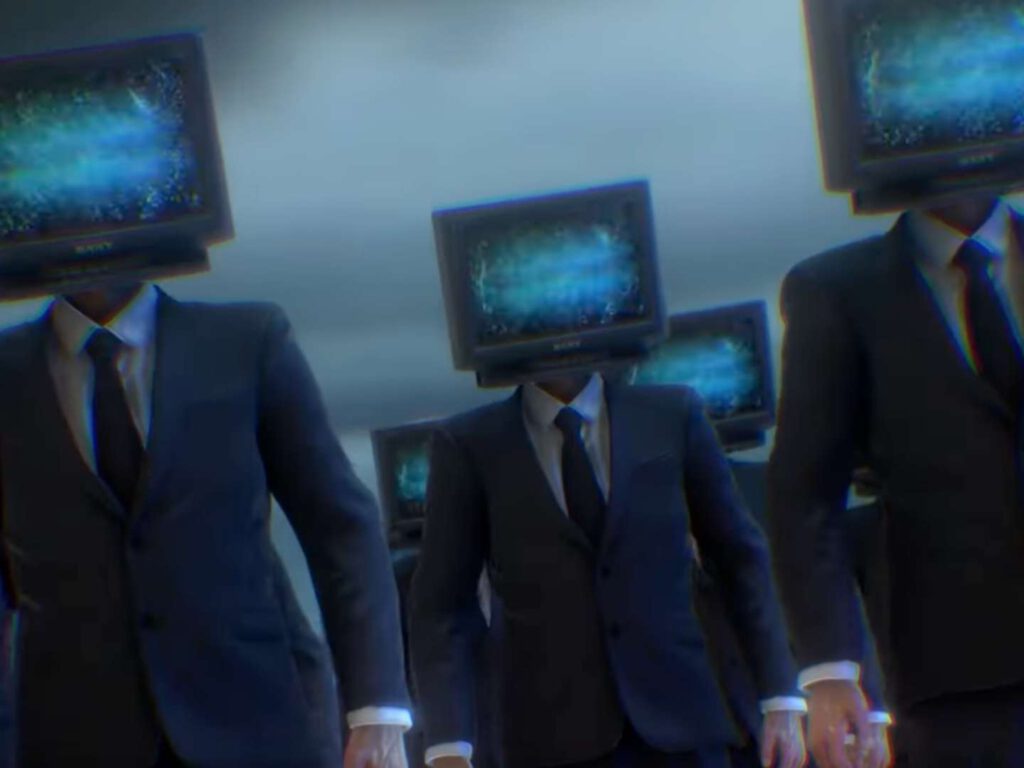Was für weniger Krankenhausbetten spricht

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Herzinfarkt. Sehr schlecht, da will man schnelle Hilfe. Also: Hoffentlich gibt es einen Defibrillator und kompetente Ersthelfer:innen, ein rasches Eintreffen der Rettung und ein Krankenhaus in der Nähe. Dann spielt es auch eine große Rolle, was für ein Krankenhaus das ist und wie oft das Personal dort einen Herzinfarkt behandelt. Mit einer richtig gut ausgestatteten Abteilung kann das verschlossene Gefäß geöffnet werden, dafür wird meist ein Ballon in die Herzgefäße eingeführt und aufgeblasen. Klingt kompliziert? Ist es auch. Deshalb kann man wohl sagen: Sie wollen, dass Ihr:e Ärzt:in diesen Eingriff häufig durchführt und nicht nur fünfmal im Jahr.
Ähnlich verhält es sich bei vielen anderen Bereichen. Schlaganfallbehandlung, Geburten, den Einsatz eines neuen Gelenks: lauter Eingriffe, bei denen Sie wollen, dass das durchführende Personal in der Übung ist. Denn auch Medizin ist ein Handwerk. Das wird aber oft vergessen. Das Bedürfnis ist eine möglichst gute und umfassende Versorgung direkt in der Nähe.
Nahe ist nicht immer besser
Geht bei einer Geburt etwas schief, wird operativ eingegriffen, was die Sterblichkeit von Müttern und Babys bei der Geburt massiv sinken hat lassen. Bei einem Herzinfarkt sieht man direkt in Gefäße hinein, es gibt Operationsroboter, und bei einer Krebsdiagnose gibt es durch Operationen und Therapien heute teilweise wirklich gute Überlebensraten. Diese technischen Veränderungen haben auch zu anderen Bedingungen für Patient:innen geführt. Wer sich am Knie verletzt hat und am Meniskus operiert wird, musste vor dreißig Jahren mit mehreren Übernachtungen im Krankenhaus rechnen, heute kann dieser Eingriff in weniger als einer halben Stunde durchgeführt werden, und es ist keine einzige Übernachtung im Krankenhaus nötig. Diese technischen Weiterentwicklungen setzen aber auch andere Kompetenzen voraus, als Medizin sie früher verlangt hat.
Das Gesundheitssystem und die Erwartungshaltung daran haben sich an diese Entwicklung aber nicht angepasst. Österreich liegt mit knapp sieben Betten pro 1.000 Einwohner:innen im OECD-Vergleich auf Platz vier bei den Krankenhausbetten (nach Korea, Japan und Deutschland). Doch seit Jahren sind immer wieder Betten gesperrt, weil es nicht genug Personal dafür gibt. In der Praxis existieren sie also nicht. Und die Statistiken zeigen, dass es nach wie vor oft zu längeren Krankenhausaufenthalten kommt als nötig. Wie gut ist es also, so viele Krankenhausbetten zu haben?
Eine Frage der Qualität
Potenziell spielt hier auch die Erwartungshaltung mit hinein. Früher waren Krankenhäuser oft die einzigen Orte für Röntgen, die einzigen Orte, wo man einen Gips bekommen hat et cetera. Doch mit dem technischen Fortschritt wächst das Aufgabengebiet und damit auch die notwendigen Kompetenzen. Denn einen Gips kann man halbwegs leicht begleiten. Einen Herzkatheter, eine Gehirnoperation oder eine Transplantation kann man aber nicht so einfach machen. Dafür braucht es Können und vor allem Übung. Das führt dazu, dass Abteilungen immer spezialisierter werden und dementsprechend nicht jedes Krankenhaus jeden Eingriff durchführen kann. Weil das aber nicht unbedingt im breiten Bewusstsein ist, ist die öffentliche Anforderung: ein Krankenhaus in der Nähe. Doch wenn es überall Krankenhäuser gibt, haben diese häufig Personalmangel oder zumindest exorbitante Personalanforderungen. Immerhin braucht es ein gewisses Minimum an Abteilungen, damit sich der Betrieb rentiert.
Gleichzeitig führt mangelnde Übung an Eingriffen dazu, dass sie gefährlicher werden. Genau deshalb müssen Ärzt:innen während der Ausbildung die diversen Eingriffe oft genug üben. Dafür muss eine Abteilung aber groß genug sein. Im Krankenhaus Rottenmann in der Steiermark gab es zuletzt nur 242 Geburten im Jahr, also nicht einmal eine pro Tag. Laut Qualitätsvorgaben des Bundes sollten aber mindestens 365 Entbindungen pro Jahr in einer Abteilung durchgeführt werden. Anders gesagt: In der Region kommen zu wenig Kinder auf die Welt, um eine eigene Geburtenstation im Krankenhaus Rottenmann sicher zu betreiben.
Populismus als Hindernis
Auch deshalb wurde in der Obersteiermark lange darüber diskutiert, wie die Gesundheitsversorgung aussehen kann. Aktuell gibt es in Rottenmann, in Bad Aussee und in Schladming Krankenhäuser. Gemessen an der Distanz zwischen den Krankenhäusern und den Leistungen, die diese erbringen, sind das zu viele Spitäler für die Region. In fast jahrzehntelanger Diskussion hat man sich deshalb darauf geeinigt, in Liezen ein gemeinsames Leitspital zu errichten. Damit sollten die Kompetenzen gebündelt werden, aus den bestehenden Standorten hätte man beispielsweise Primärversorgungszentren machen können, um den täglichen Bedarf an Gesundheitsversorgung, der sich sonst in Krankenhausambulanzen ansammelt, zu bewältigen. Allerdings bedeutet ein Krankenhaus um die Ecke eben mehr gefühlte Gesundheitsversorgung – Mindestfallzahlen oder Qualität spielen in der emotionalen Debatte selten eine Rolle. Vielleicht ist das Leitspital gerade aufgrund der Gefühlsebene im blau-schwarzen Regierungsprogramm jetzt Geschichte.
Für das Gefühl, welche Gesundheitsversorgung zur Verfügung steht, mag das ein Sieg sein. Für die Qualität dieser Versorgung allerdings nicht. Nicht zu vergessen, dass der anhaltende Personalmangel im Gesundheitsbereich wohl dazu führen wird, dass in den drei Krankenhäusern nicht immer alle Angebote aufrechterhalten werden können. Denn auch für das Personal ist die Zusammenlegung ein Vorteil. Der Arbeitsweg mag zwar eine halbe Stunde länger sein, durch die größeren Abteilungen steht aber mehr Personal zur Verfügung. Das bedeutet, dass ruhig einmal jemand krank sein kann, ohne dass Kolleg:innen einen Urlaubstag stornieren müssen, dass hin und wieder zwanzig Minuten mehr zur Verfügung stehen könnten, um ordentlich mit einer Patientin zu sprechen und dass aus drei IT-Systemen eines werden kann – wodurch mehr Geld zur Verfügung steht, um dieses gut aufzusetzen und für mehr Automatisierung im Datenabgleich zu nutzen, sodass Mitarbeiter:innen nicht nach jedem Dienst noch eine Stunde Patient:innenakten in den Computer tippen müssen.
Minimum nicht erreicht
Das Problem in Österreich ist aber auch, dass jeder Bürgermeister sozusagen „sein“ Krankenhaus behalten will. Immerhin bedeutet ein Krankenhaus im Ort auch Arbeitsplätze und damit Gemeindeeinnahmen, Aufträge für die regionale Wirtschaft (klassisches Beispiel ist die Bäckerei für die Frühstückssemmeln) und Ansehen. Deshalb hat man vor einiger Zeit mit sogenannten Krankenhausverbänden begonnen. Ein Beispiel wäre das Landeskrankenhaus Baden-Mödling in Niederösterreich. Dort hat der Rechnungshof schon vor der Eröffnung festgestellt, dass zwei Standorte zu unnötigen Kosten führen und sich negativ auf die Versorgung auswirken. Denn es ist sehr teuer, an beiden Standorten beispielsweise MRT-Geräte aufzustellen. Die ersten Jahre wurden stationär aufgenommene Patient:innen deshalb mit der Rettung von einem Krankenhaus ins andere und wieder zurück geführt, wenn sie eine solche Untersuchung gebraucht haben. Eine mögliche Lösung, aber eine teure, die obendrein für Patient:innen unangenehm ist und zusätzlich bei der Rettung hohe Kosten verursacht.
Die vielen Krankenhäuser, die es braucht, um immer eines in der Nähe zu haben, machen das Gesundheitssystem also unnötig teuer und sind ein Risikofaktor für die Qualität. Nachdem es so viele kleine Krankenhäuser gibt, ist auch davon auszugehen, dass mehrere diese Mindestfallzahlen unterschreiten. Erschwert wird das Ganze dadurch, dass es in Österreich nur für wenige Eingriffe Mindestfallzahlen gibt. Würde man mit internationalen Mindestfallzahlen vergleichen, ist davon auszugehen, dass diese öfters unterschritten werden. So wurden im Krankenhaus Lilienfeld in Niederösterreich im letzten Jahr beispielsweise nur 17 Hüftgelenke eingesetzt, das entspricht ungefähr einem Zehntel der Fälle in anderen (kleineren) Krankenhäusern. Im Krankenhaus Laas in Kärnten wurden nur elf Herzinfarkte behandelt.
Trotzdem sorgten in Niederösterreich Pläne über Spitalsschließungen im ersten Moment für Entrüstung und wurden als Bedrohung wahrgenommen. In der genaueren Berichterstattung wurde aber klar, dass Expert:innen aus der Medizin und der Gesundheitsökonomie für diese Schließungen sind. Fraglich ist allerdings, wie diese Fakten in Zukunft besser kommuniziert werden können. Denn emotional sind Krankenhausschließungen vielleicht eine Bedrohung. Geht es aber um die Qualität der Gesundheitsversorgung, sind sie ein Fortschritt. Auf lange Sicht ist also sowohl für Patient:innen als auch für das Gesundheitsbudget nur eine Lösung naheliegend: Wir brauchen weniger Krankenhausbetten.