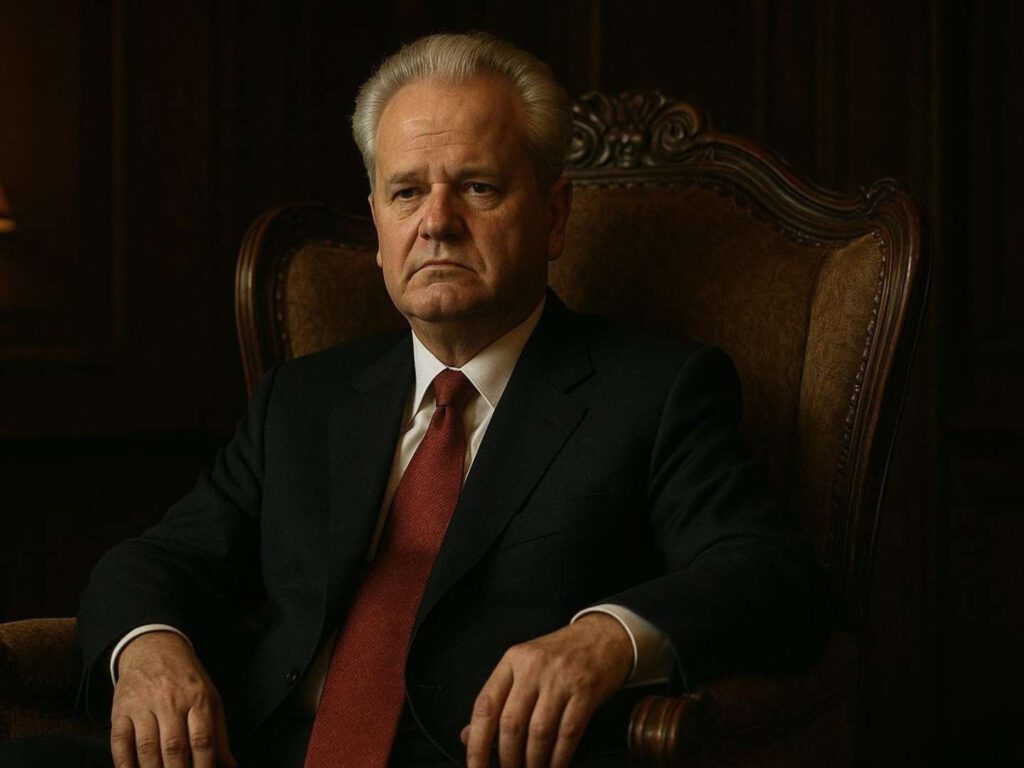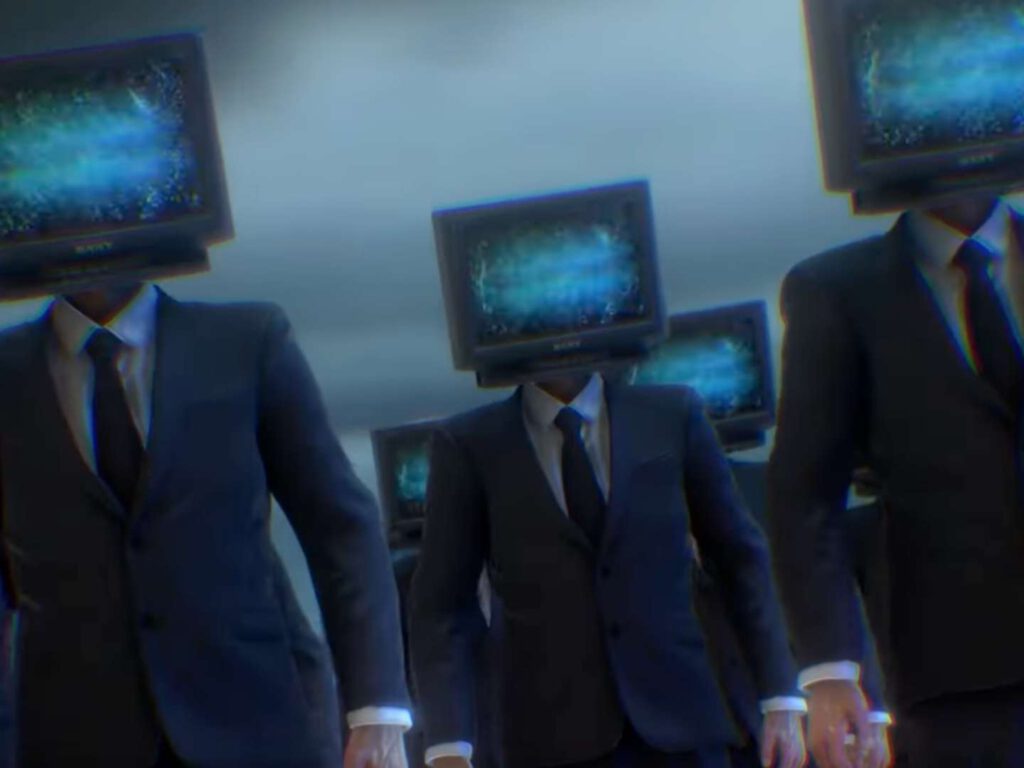Wer darf Atomwaffen haben – und wer nicht?

Atomwaffen gelten als die ultimativen Werkzeuge militärischer Macht – und als potenzielle Auslöser der nächsten globalen Katastrophe. Neun Staaten weltweit haben Atomwaffen, doch nur fünf davon dürfen offiziell Sprengköpfe besitzen.
Atomare Zweiklassenwelt?
Die internationale Ordnung rund um Atomwaffen beruht auf dem 1970 in Kraft getretenen „Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen“, auch als Atomwaffensperrvertrag oder NPT (Non-Proliferation Treaty) bekannt. Initiiert wurde er 1968 von den Atommächten USA, Großbritannien und Sowjetunion, unterzeichnet haben ihn bis heute 191 Länder. Er erlaubt offiziell nur fünf Staaten – den USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien – den Besitz von Atomwaffen. Sie gelten als „anerkannte Nuklearmächte“, weil sie vor 1967 entsprechende Waffen getestet haben. Alle anderen Staaten haben sich völkerrechtlich verpflichtet, keine Atomwaffen zu entwickeln oder zu erwerben. Im Gegenzug wurde ihnen die friedliche Nutzung der Kernenergie erlaubt – unter strenger Kontrolle durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) . Die zentrale Kontrollinstanz des NPT ist die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO), eine UN-nahe Organisation mit Sitz in Wien. Ihre Aufgabe ist es sicherzustellen, dass nukleare Programme weltweit zivilen Zwecken dienen – also etwa der Stromerzeugung – und nicht zur Entwicklung von Atomwaffen zweckentfremdet werden. Die IAEO führt Inspektionen durch, analysiert nukleare Anlagen und überwacht die Einhaltung internationaler Abkommen. Doch die IAEO hat keine eigenen Sanktionsmöglichkeiten.
Für die fünf Atommächte besteht zwar eine Verpflichtung zur Abrüstung , Es gibt auch Beispiele dafür, dass Staaten sich aktiv und freiwillig gegen Atomwaffen entscheiden. Südafrika etwa war das erste Land, das freiwillig und nachweislich sein Atomwaffenprogramm beendet hat. In den 1980er Jahren hat das damalige Apartheid-Regime sechs Atombomben gebaut. 1991 – noch vor dem politischen Übergang – hat das Land beschlossen, alle Sprengköpfe zu vernichten, und ist dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten. Nach dem Zerfall der Sowjetunion haben die Ukraine, Belarus und Kasachstan auf hunderte sowjetische Atomwaffen verzichtet, die auf ihren Territorien gelagert wurden. Sie haben diese an Russland zurückgegeben und sind ebenfalls dem Sperrvertrag beigetreten. es gibt dafür aber keine Frist – und die Verpflichtung wird bis heute nicht erfüllt. Ganz im Gegenteil: Laut dem Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) steigt die Zahl der einsatzfähigen Sprengköpfe wieder, ebenso die Investitionen in neue Technologien – etwa Hyperschallraketen oder kleinere, taktische Atomwaffen.
Wieso wird das toleriert? Die Antwort liegt wohl weniger im Völkerrecht als in der realpolitischen Machtverteilung. Staaten mit starkem geopolitischem Einfluss setzen ihre Interessen leichter durch – während andere schnell unter Verdacht und Druck geraten. Das führt zu einer zweigeteilten Ordnung: eine Welt der „legalen“ Atommächte – und eine Welt der Verdächtigten.
Wer besitzt Atomwaffen – und warum?
Neben den offiziellen fünf Atommächten gibt es vier weitere Staaten mit Nuklearwaffen – alle vier sind dem Vertrag nicht beigetreten: Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea.
Israel
Israel hat nie bestätigt, Atomwaffen zu besitzen – aber es gilt als sicher, dass das Land seit den 1960er Jahren über ein Arsenal verfügt. Es wird für seine vermuteten Atomwaffen aber kaum kritisiert. Das liegt auch daran, dass Israel als berechenbar gilt – und starke Verbündete hat.
Indien und Pakistan
Indien hat in den 1970er und Pakistan in den 1990er Jahren erfolgreich Atomwaffen getestet. Die weltweite Empörung war damals groß, hat sich aber mittlerweile gelegt. Denn die Arsenale der verfeindeten Nachbarländer gelten als Teil eines regionalen Gleichgewichts, vor allem wegen des Konflikts um Kaschmir.
Nordkorea
Nordkorea ist dem NPT beigetreten und 2003 wieder ausgetreten, um anschließend Atomwaffen zu testen. Das Land gilt wegen seiner Isolation und der militärischen Rhetorik als unberechenbar, weshalb sein Nuklearprogramm international als besonders gefährlich wahrgenommen wird.
Und der Iran?
Der Iran ist ein Sonderfall: Er ist Mitglied des NPT und darf offiziell keine Atomwaffen bauen. Gleichzeitig nutzt er Urananreicherung zur Energiegewinnung – was grundsätzlich erlaubt ist, aber auch militärisch nutzbar gemacht werden kann. Deshalb steht das Land unter Dauerbeobachtung der IAEO.
Die USA und Israel verdächtigen den Iran seit Jahren, heimlich an Atomwaffen zu arbeiten. Teheran bestreitet das. Die Reaktion: gezielte Angriffe auf iranische Nuklearanlagen, Sabotageaktionen und Sanktionen. Dass Israel mutmaßlich selbst über Atomwaffen verfügt, aber den Iran gewaltsam von einer Bombe abzuhalten versucht, zeigt eine gewisse Asymmetrie der internationalen Ordnung.
Beurteilt wird dabei meist danach, ob ein Land als berechenbar oder gefährlich gilt. Demokratische Staaten mit stabilen Institutionen wird oft mehr zugetraut als autoritären Regimen, die auch im Inneren rücksichtslos agieren (siehe auch Nordkorea). Im Fall des Iran kommt hinzu, dass er immer wieder das Existenzrecht Israels bestritten und es wiederholt indirekt über Milizen wie die Hamas angegriffen hat.
Gleiches Spiel, unterschiedliche Regeln
Die Frage, wer Atomwaffen besitzen darf, ist nicht nur eine juristische, sondern vor allem eine politische. Atomwaffen sind nicht gleich verteilt – und nicht gleich bewertet. Wer sie hat, bestimmt oft mit, wer sie nicht haben darf. Der Atomwaffensperrvertrag war ein Versuch, die Verbreitung einzudämmen, aber er spiegelt bis heute das Machtgefüge der 1960er Jahre wider. Statt Abrüstung erleben wir eine neue Phase der nuklearen Aufrüstung. Konflikte wie der Krieg in der Ukraine oder die Eskalation im Nahen Osten schwächen die internationale Atomdiplomatie, heißt es vom SIPRI. Doch Vertrauen, Transparenz und Berechenbarkeit spielen eine große Rolle in der internationalen Wahrnehmung, wer Atomwaffen besitzen darf – und wer nicht.