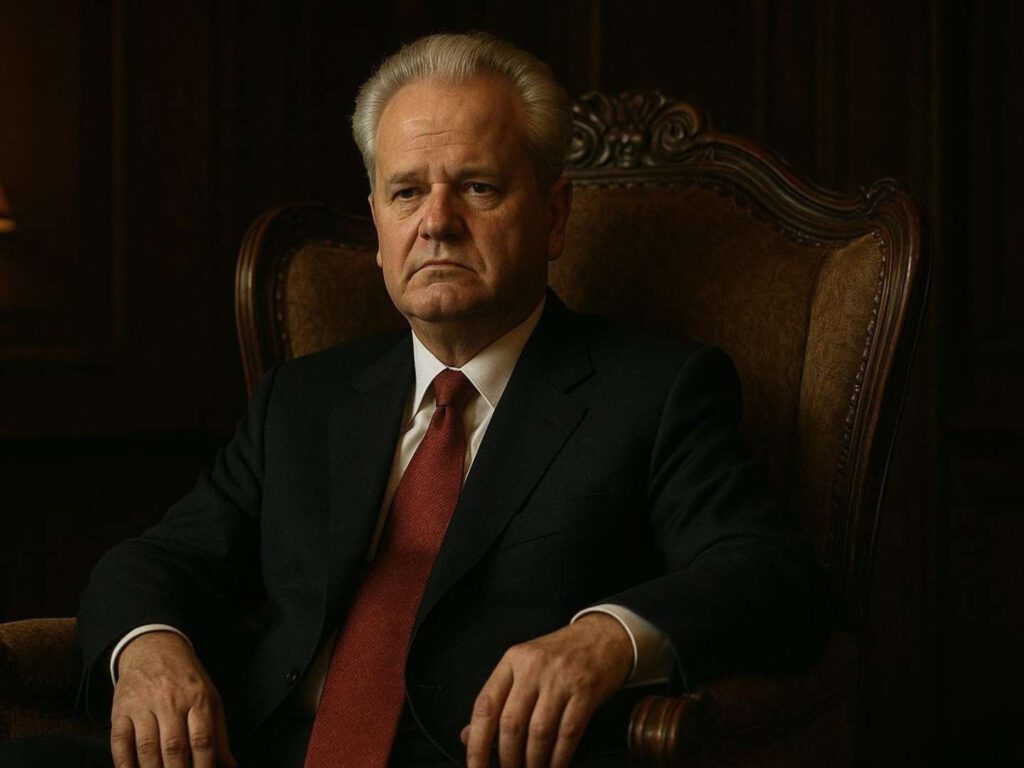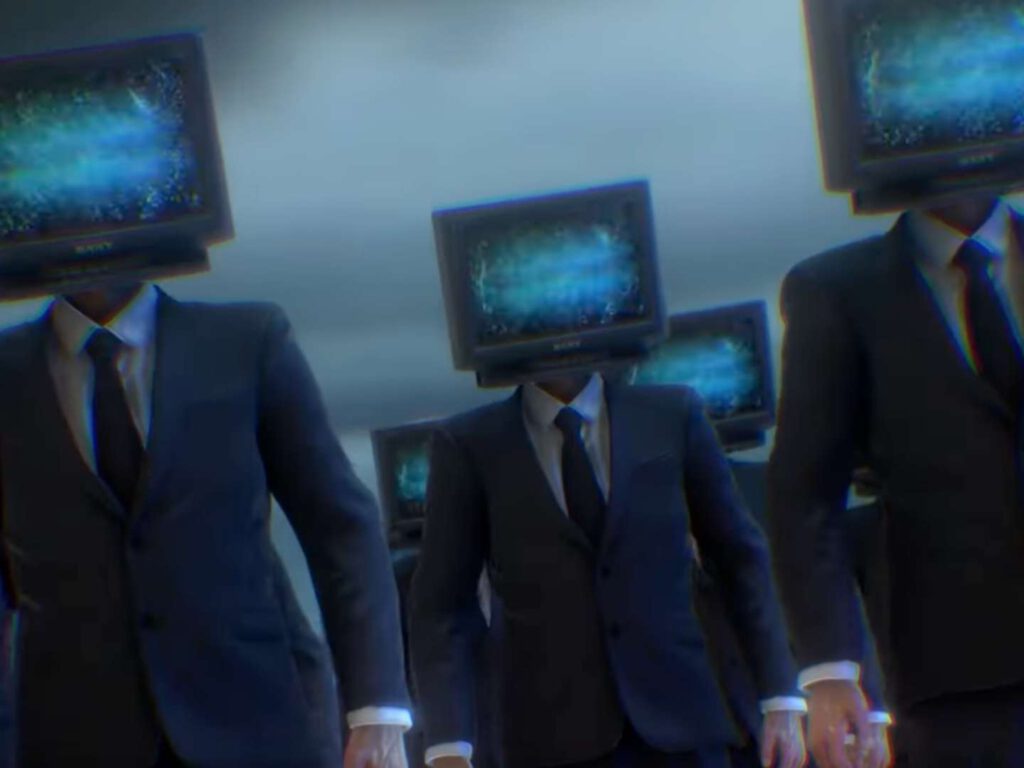Geht Europa das Wasser aus?

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace bemängelt den Zustand des Grundwassers: An rund 60 Prozent der Messstellen in Österreich ist ein niedriger bis sehr niedriger Grundwasserstand festgestellt worden. Besonders betroffen sind die westlichen Bundesländer. Dort hatten sich der schneearme Winter und der regenarme Frühling entsprechend ausgewirkt. Was für Österreich gilt, kann für weite Teile Europas ebenso gelten.
In Mitteleuropa leben wir zwar vergleichsweise noch auf einer Insel der Seligen, aber Warnsignale sollten deswegen nicht übersehen oder falsch gedeutet werden. Die Auswirkungen zunehmender Hitze haben wir seit 2018 ganz drastisch zu spüren bekommen. Auf natürlichem Weg muss künftig so viel Wasser wie möglich aufgefangen und zurückgehalten werden. Wenn es zu viel Wasser auf einmal gibt, braucht es Raum, damit es sich – ohne Schaden anzurichten – ausbreiten und versickern kann. Die vielen versiegelten Flächen in Städten verhindern den Wasserabfluss, wenn es besonders stark regnet. Das Abwassersystem ist schnell überfordert. Und wenn es lange trocken ist, fehlt andererseits das Wasser.
Im Gegensatz zu vielen Staaten in Südamerika, Asien und vor allem Afrika wird Europa die Folgen der klimatischen Veränderungen mittels seiner finanziellen, technischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten vermutlich in Grenzen halten und Lösungen finden können – aber die Zeit drängt.
Rhein-Anrainer gehen mit gutem Beispiel voran
Das Jahr 2020 war in Europa das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen, und weitere wärmste Jahre folgten. In Europa werden die Temperaturen nach Angaben des Weltklimarats IPCC stärker steigen als im weltweiten Durchschnitt. Die Häufigkeit und Intensität der Hitzeextreme wird zunehmen. Die EU-Mitgliedstaaten haben schon vor 25 Jahren erkannt, wie wichtig Gewässerschutz ist und im Jahr 2000 ein umfangreiches Regelwerk zum Schutz von Flüssen, Seen, Küstengewässern und Grundwasserressourcen verabschiedet: die Wasserrahmenrichtlinie. Zu den Maßnahmen gehören der Abbau von Subventionen etwa für die Landwirtschaft oder die Energiewirtschaft und der Aufbau eines Solidaritätsfonds für übergreifende Aufgaben, beispielsweise zur Reduzierung der Schadstoffbelastung in Flüssen.
30 Millionen Menschen erhalten ihr Trinkwasser aus dem Rhein. Die Anrainerstaaten Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande gründeten deshalb schon vor fünfzig Jahren die internationale Kommission zum Schutz des Rheins. Man hat durch Vereinbarungen mit der Industrie die Einleitung von chemikalienverunreinigtem Wasser reduziert, den Gewässerschutz ausgebaut und den Bau von Kläranlagen forciert. Die Wasserqualität des Rheins verbesserte sich drastisch, und heute gibt es dort auch wieder Lachse. Zudem warnt ein multinationales Alarmsystem die Städte flussabwärts, wenn durch einen Unfall Gift ins Wasser geflossen ist – wie 1986 beim Großbrand in einer Lagerhalle des Schweizer Chemieunternehmens Sandoz in Basel. Diese Umweltkatastrophe war damals der entscheidende Warnschuss.
Beim Wasser scheiden sich in Spanien die Geister
Fast alle Mittelmeer-Anrainerstaaten kämpfen mit sinkenden Grundwasserspiegeln. Was auf sie alle noch zukommen könnte, hat Südspanien besonders schmerzlich zu spüren bekommen: Nachdem jahrelang kaum Regen gefallen ist, gleicht das Land vielerorts einer Steppe. Spanien rationierte zuletzt fast jährlich das Trinkwasser. Doch Wassersparen war lange überhaupt nicht angesagt, auch nicht, als sich sogar in vergleichsweise wasserreichen Staaten wie Deutschland der sparsamere Umgang durchsetzte.
In Kastilien-La Mancha weigerten sich die Menschen, weiter Wasser aus dem Tejo in die Regionen Valencia und Murcia zu liefern. Der Grund: Auch die eigenen Stauseen waren fast leer, und einige Ortschaften mussten schon mit Wasser aus Tanklastern versorgt werden. Pläne für umfangreiche Kanalprojekte in Spanien, mit denen das Wasser umgeleitet und dorthin gebracht werden soll, wo es fehlt, stoßen inzwischen auf heftigen Widerstand. Nicht alle Bewohner finden es gut, wenn „ihr“ Wasser in Regionen umgeleitet wird, in denen man mit dem kostbaren Nass verschwenderisch umgeht.
Der lawinenartig zunehmende Tourismus, die vielen Golfplätze, die Pools, parkartige Hotel- und Ferienanlagen, viele Kilometer lange Bewässerungsfelder unter Plastikplanen mit Obst- und Gemüseanpflanzungen und neue Industrieansiedlungen ausgerechnet in den ohnehin schon trockenen Regionen des Landes führten dazu, dass Spanien mittlerweile zum EU-Staat mit den größten Wassersorgen geworden ist.
Heu aus Kalifornien für Kühe in Saudi-Arabien
Nach wie vor wird wasserintensives Getreide, Obst und Gemüse gerade dort angebaut, wo Wasser knapp ist. Das ist nicht nur in Spanien so. Zudem ist Wasser oft dort am billigsten, wo es knapp ist. In einigen süd- und mittelamerikanischen Städten gibt es noch Flatrates fürs Wasser. Das ist kein Anreiz zum Sparen. Ein Beispiel für den sorglosen Umgang mit dem raren Wasser sind Farmer im trockenen Kalifornien, die Heu produzieren, das dann nach Saudi-Arabien verschifft wird, wo es an Hunderttausende von Milchkühen in klimatisierten Ställen in der Wüste verfüttert wird.
Die Fleischerzeugung benötigt riesige Wassermengen, und mit steigendem Einkommen und Streben nach Wohlstand essen die Menschen mehr Fleisch. Wohlstand zeigt sich nach wie vor weltweit vor allem am Verzehr von Rindern und Schweinen. Es muss ein Bewusstseinswandel einsetzen, der zur Änderung der Essgewohnheiten führt: Es ist entscheidend, den Fleischverbrauch zu senken. Immerhin beginnt sich dieses Bewusstsein in Mitteleuropa langsam zu entwickeln
Wir werden humanitäre Katastrophen miterleben
Gleichzeitig werden wir uns mit den Auswirkungen in anderen Regionen und auf anderen Kontinenten, insbesondere Afrika, auseinandersetzen müssen. Die „Festung Europa“ wird mit weiteren großen Flüchtlingsströmen konfrontiert und in Konflikte um Ressourcen und Handelswege hineingezogen werden. Wir werden humanitäre Katastrophen in anderen Gegenden miterleben und eingreifen müssen, um noch Schlimmeres zu verhindern. Auch Interventionen militärischer Natur sind aus sicherheitspolitischen Gründen keineswegs mehr ausgeschlossen. Denn Wasser wird zunehmend auch machtpolitisch benutzt.
Die Ungleichheit der Süßwasserverteilung wird sich verstärken. Umgekehrt lässt sich auch sagen, dass die Bevölkerung auf der Erde offensichtlich falsch verteilt ist. In Asien leben inzwischen 60 Prozent der Erdenbürger, es verfügt aber nur über etwas mehr als ein Drittel der weltweiten Süßwasservorkommen. In Afrika, wo die meisten Menschen in trockenen Zonen leben, nimmt die Menge des Wassers in Flüssen und Seen ab, die Dürre- und Wüstenfläche dagegen legt zu, während gerade dort die Bevölkerungszahl stark zunimmt und damit noch mehr Menschen Wasser und Nahrung benötigen. Das hat Konsequenzen, denn so banal das klingt: Wenn das Wasser nicht mehr zum Menschen kommt, geht der Mensch zum Wasser.
Mehr Nahrung pro Tropfen
Die Bauern in Afrika, insbesondere in der Sahelzone, müssen mit angepassten Anbaumethoden vertraut gemacht werden und gleichzeitig die Möglichkeit erhalten, Regenwasser aufzufangen und Dünger und Saatgut für resistente Pflanzen zu kaufen. Länder müssen dazu befähigt werden, aus der Produktion wasserintensiver Anbauprodukte auszusteigen und umzusatteln. Mehr Nahrung pro Tropfen ist das Stichwort, denn wo Wasser immer knapper ist, wird der Hunger zunehmen. Ernährungssicherheit herzustellen, ist von elementarer Bedeutung für jeden Staat, aber längst nicht mehr überall gewährleistet. Viele weichen deshalb schon in vermeintlich bessere Regionen aus oder flüchten gleich weiter bis nach Europa.
In vielen Staaten werden anhaltende Dürren, Wassermangel, Überflutungen oder Wirbelstürme das Risiko von Instabilität erhöhen und neue Krisen heraufbeschwören. Die Sicherheitsaspekte rund ums Wasser werden künftig die NATO und die EU beschäftigen. Sich rechtzeitig darauf vorzubereiten und Szenarien zu entwickeln, gehört zur Vor- und Fürsorge. Deutschland hat nun nach langem Hin und Her einen nationalen Sicherheitsrat eingesetzt, den Österreich schon hat, wo Szenarien und Pläne für verschiedenste Eventualitäten ausgearbeitet werden sollen.
Horrorszenario: Cyberattacken auf die Wasserinfrastruktur
Cyberattacken auf Wasserinfrastrukturen, Kraftwerke und die Netzverteilung sind Horrorszenarien. Die Militärs, die NATO, Bundesheer und Bundeswehr – sie alle haben erkannt, dass es ein gefährliches Potenzial an mehr oder weniger ungeschützten Angriffszielen in der modernen Gesellschaft gibt. Eine sichere Versorgung mit Trinkwasser muss zentraler Bestandteil der nationalen Sicherheit werden. Nationale Wasserstrategien sind ein wichtiger Rahmen, um den nachhaltigen Umgang mit Wasser zu sichern. Sie sollen die Wasserressourcen schützen, die Qualität verbessern und die künftige Versorgung gewährleisten.
Das kostbare Nass intelligent verteilen
In Europa muss Wasser in Stauseen, Flüssen und Kanälen sowohl in Trockenperioden als auch bei Starkregenereignissen intelligent verteilt werden. Es muss flussübergreifend ein Zusammenspiel geben, das mittels Sensoren von KI gesteuert werden könnte. Schon heute sind viele Talsperren und Flüsse sowie Kanäle auf diese Weise vernetzt. Das muss aber bundesweit und auch grenzüberschreitend geschehen. Wasser muss umfassend „verwaltet“ werden. Sorglosigkeit im Umgang mit Wasser ist nicht mehr angebracht: Süßwasser ist auch im regenreichen Mitteleuropa eine endliche Ressource.
JÜRGEN RAHMIG ist seit 40 Jahren Zeitungsredakteur mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik sowie Verfasser von Büchern zum politischen Zeitgeschehen. Er berichtet aus Krisengebieten und ist seit 25 Jahren regelmäßig auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu Gast. In seinem Buch „Der Kampf ums Wasser“ (S. Hirzel Verlag) beleuchtet Jürgen Rahmig die Konflikte rund um die Ressource Wasser im 21. Jahrhundert.