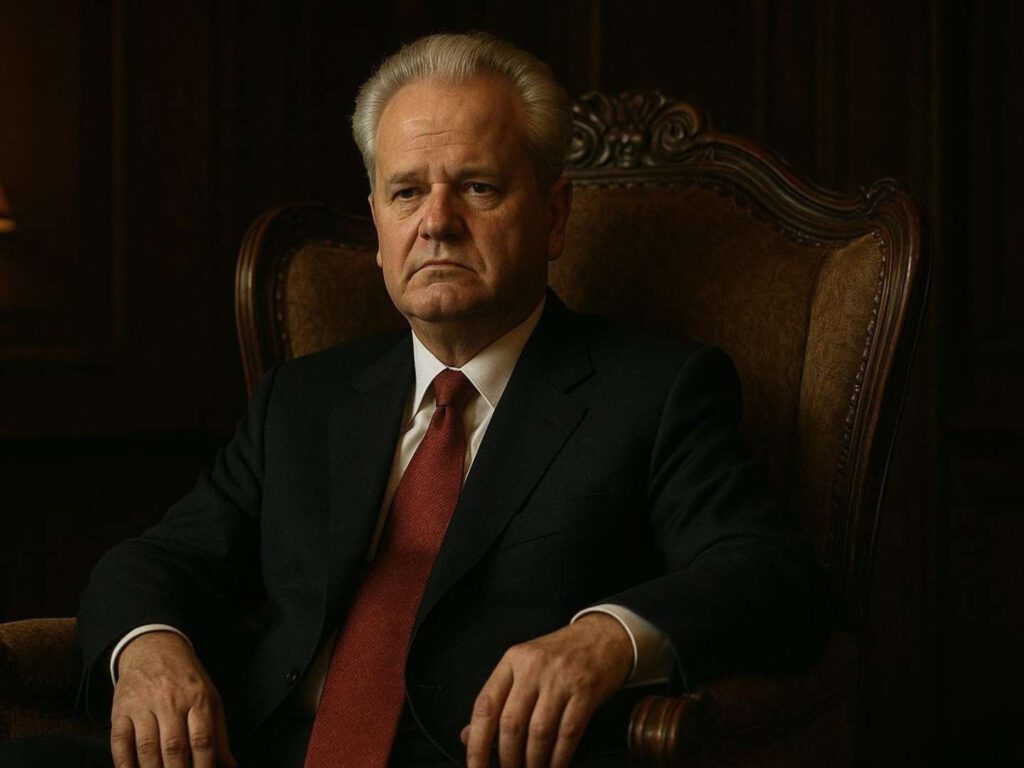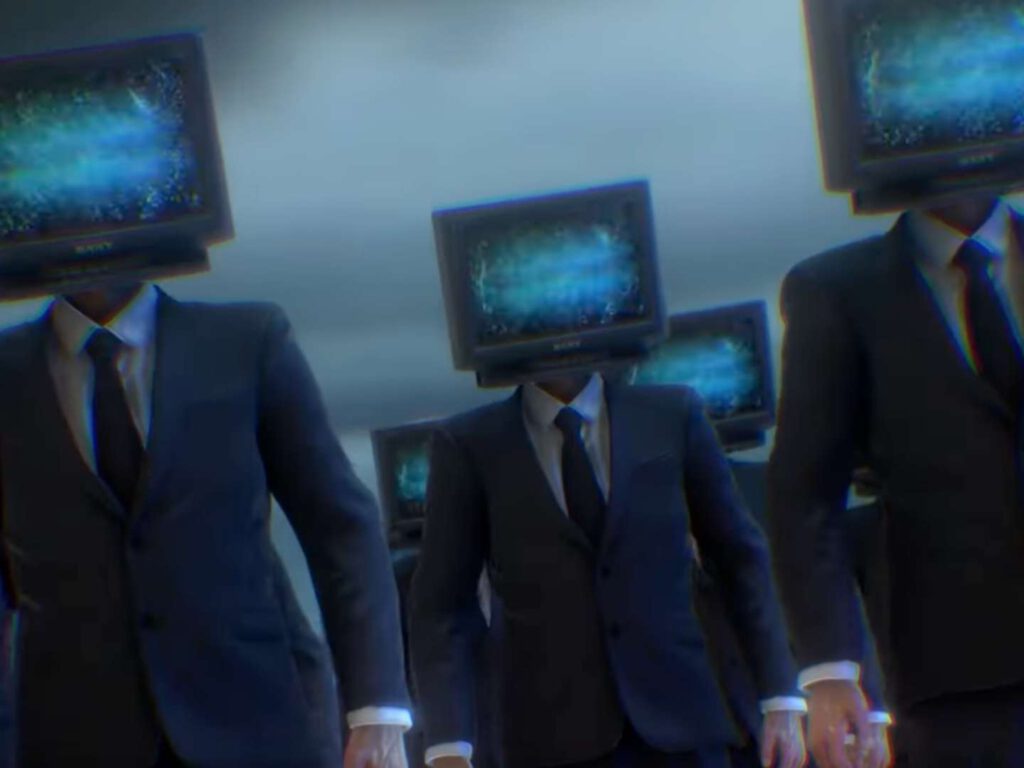Migration: Mittelamerika in der Zwickmühle

Trumps harte Migrationspolitik verschärft die Krise in Mittelamerika: Abschiebungen und Grenzschließungen führen zu Chaos, unterdessen treiben Armut, Gewalt und Klimawandel Menschen weiter in die Flucht. Die betroffenen Länder sind überfordert.
Die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und seine sofort gestarteten Abschiebungen sorgen unter den Flüchtlingen in Mexiko und Mittelamerika für Verunsicherung und Chaos. Viele Migranten stranden in Mexiko und wissen nicht, wohin oder wie es weitergehen soll. In der mexikanischen Grenzstadt Tijuana ist die Verzweiflung groß: Es herrscht Ausnahmezustand, und es gibt Anzeichen von Fremdenfeindlichkeit gegenüber Migranten. Eigentlich bringt Mexiko ihnen Verständnis entgegen – viele Mexikaner sind selbst in die USA geflüchtet, viele haben dort Bekannte und Verwandte. Aber die Flüchtlingsgruppen, die auf den Straßen campieren, dort ihre Notdurft verrichten und betteln, verstärken eine Anti-Haltung. Hinzu kommt, dass auch Mexiko selbst auf die Bremse tritt, um angedrohte US-Zölle zu vermeiden.
Nach den Maßnahmen der neuen Trump-Administration machen einige Migranten auf ihrem langen Weg durch die mittelamerikanischen Staaten, der oft einem Spießrutenlauf ähnelt, nun kehrt oder versuchen sich neu zu orientieren. Das gilt parallel dazu für die Fluchthelfer, die nach neuen Möglichkeiten suchen, die Menschen gegen immer mehr Bares über die Grenzen zu schleusen.
Darién – eine der gefährlichsten Fluchtrouten der Welt
Auf der Flüchtlingsroute durch das Nadelöhr des berüchtigten Darién-Urwalds zwischen Süd- und Mittelamerika gab es zuletzt immer neue Rekordzahlen. In manchen Monaten sind es nahezu 100.000 Menschen, die den gefährlichen Weg aus Südamerika und über Kolumbien durch den Darién nach Panama und von da aus weiter nach Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador und schließlich Mexiko wählen. Die meisten wollen dort über die Grenze in die USA. Wer kann, umschifft diesen heiklen Abschnitt der Strecke im wahrsten Sinne des Wortes über See. Denn die Dschungelroute nutzen auch Drogensyndikate und Waffenschmuggler. Die Mehrheit der Migranten auf der Darién-Route kommt vor allem aus Venezuela (60 Prozent), Ecuador und Haiti. Die USA haben gegen Venezuela, wo sich Präsident Maduro mit gefälschten Wahlen an der Macht hält, wirtschaftliche Sanktionen erhoben. Diese Beschränkungen verschärfen die wirtschaftliche Situation und erzeugen so noch mehr Migrationsdruck. Und allein im März 2025 schob Washington 250 Venezolaner nach El Salvador ab. Das Besondere daran: Das geschah sogar entgegen der Entscheidung eines US-Bundesrichters.
Die Lage in Venezuela ist desolat. Die Venezolaner fordern einen politischen Wandel. Trotz der Manipulationen und Unmöglichkeit vieler Oppositioneller, bei Wahlen antreten zu können, gab es am 25. Mai 2025 Parlaments- und Regionalwahlen. Die Opposition hatte die Wahlen aus Protest gegen die offensichtlich manipulierten Präsidentschaftswahlen 2024 boykottiert. So wollten sie diese Wahlen zu einer Farce machen. Entsprechend deutlich war daher der Sieg von Staatschef Maduro. Er wird die Venezolaner nun eine weitere Amtszeit drangsalieren.
Panama würde durch den Darién-Dschungel gerne eine Straßenverbindung an die kolumbianische Grenze bauen. Doch zwei Gründe halten sie bisher davon ab: Erstens kämen dann noch mehr Migranten, und zweitens würde damit auf Staatskosten eine ideale Verbindung für den illegalen Drogenschmuggel geschaffen, der von der panamaischen Polizei und Regierung noch weniger unter Kontrolle gehalten werden könnte als heute schon. Kontrollieren werden diese Straße die Kriminellen. Inzwischen ist stattdessen nun sogar die Rede von einer möglichen Mauer quer durch den Urwald.
Kriminalität profitiert von Flucht
Entlang der Fluchtrouten werden viele Migranten Opfer von Gewalt, Erpressung, Raub und sexuellem Missbrauch. Dazu gehört der Menschenschmuggel. Der Clan del Golfo, Kolumbiens größtes Gangstersyndikat, hat den unübersichtlichen Darién als Operationsbasis auserwählt. Personelle Basis des Clans sind ehemalige rechtsgerichtete Paramilitärs. Der Clan kooperiert mit dem mächtigen Sinaloa-Kartell. Es geht vor allem um Kokainherstellung und -handel. Die Regierungen und die lokalen Verwaltungen sind überfordert oder womöglich selbst in kriminelle Machenschaften verstrickt. Wer es durch den Darién schafft, ist finanziell geschröpft, körperlich geschwächt, ausgehungert, krank.
Trump hatte Kolumbien sofort nach seiner erneuten Amtseinsetzung im Januar 2025 mit Strafzoll-Androhungen dazu gezwungen, US-Militärflugzeuge mit zurückgewiesenen Migranten landen zu lassen. Zunächst hatte sich Staatschef Gustavo Petro mutig dagegen gewehrt. Kritisiert hatte er vor allem die entwürdigende Behandlung der Abgeschobenen, die wie Kriminelle behandelt würden.
Die Migranten auf der Route aus dem Süden überqueren den Fluss Suchiate, der die Grenze zwischen Mexiko und Guatemala bildet. Während die USA die Grenze nach Mexiko abschotten, versucht Mexiko dasselbe in Richtung Guatemala. Alle Migranten sollen nach Möglichkeit registriert werden. Mexiko will wissen, wer alles ins Land kommt und sich wo aufhält. Das soll auch zum Schutz der Migranten vor Kriminellen dienen.
Überforderung in Zentralamerika
In den zentralamerikanischen Staaten bringt die große Masse an durchziehenden Migranten neue und zusätzliche Probleme mit sich. Sie sind für diesen Ansturm nicht gewappnet, ihre Mittel sind äußerst begrenzt. Und sie können diese Flüchtlinge weder vor Ausbeutung im eigenen Land schützen noch sie ausreichend humanitär versorgen. Panama, wo die Menschen nach der Darién-Durchquerung landen, versucht sie zu sammeln und zu registrieren und befördert sie dann mit Bussen weiter an die Grenze nach Costa Rica. In dem Land, das als zweitälteste Demokratie der Welt nach den USA gilt, ist inzwischen der nationale Notstand ausgerufen worden.
Costa Rica sieht sich als fortschrittlichstes Land Mittelamerikas. Es verzichtet auf den Unterhalt einer Armee und hat rund 30 Prozent des Territoriums unter Naturschutz gestellt. Obwohl die „reiche Küste“ (Costa Rica) nach wie vor nicht als reich gelten kann, versucht man musterhaft zu agieren. Das Flüchtlingsproblem erzeugt in dem kleinen Land zusätzlichen Druck. Neben Costa Rica fühlt sich auch Honduras inzwischen überfordert und bittet um Hilfe, um das Migrationsproblem bewältigen zu können. Erpresserischer Druck aus den USA auf diese Staaten ist dabei – wenn überhaupt – nur bedingt hilfreich.
Armut, Kriminalität, Klimawandel
Was treibt die Menschen aus den süd- und mittelamerikanischen Ländern in Richtung USA? Im Allgemeinen ist es Armut und Perspektivlosigkeit, ausufernde Gewalt und Bandenkriminalität oder politische Konflikte. Die wirtschaftliche Lage war in Mittelamerika schon immer prekär, richtig katastrophal wurde sie für viele erst im Zuge der Globalisierung und durch den Klimawandel. Die Migration ist für die meisten nicht die erste Option, sondern der letzte Strohhalm, der ihnen geblieben ist.
Auch der wirtschaftliche Druck der USA spielt eine Rolle. Die Freihandelsabkommen, die die Regierungen des sogenannten Dreiecks Honduras, Guatemala und El Salvador mit Washington schlossen, öffneten ihre Märkte beispielsweise für Roggen, Mais und Weizen aus den USA. Der nachfolgende Preissturz zerstörte Tausende vor allem kleinbäuerliche Existenzen. Sie drängten in die Städte oder gleich Richtung Norden. Die Gründe, die die Menschen dazu bringen, ihrer Heimat den Rücken zu kehren, sind vielfältig. Neben wirtschaftlichen Aspekten sind es Gewalt und Kriminalität: Drogenkartelle, organisiertes Verbrechen, Banden, Guerillas, korrupte Polizei- oder Militärangehörige. Schwache politische Institutionen und die unsägliche Korruption begünstigen bis heute das organisierte Verbrechen.
Viele Migranten wissen, dass sie in den USA zwar offiziell nicht erwünscht sind, dass aber US-Unternehmer auf sie als billige Arbeitskräfte setzen. Ohne diese billigen Arbeitskräfte geht es vielerorts überhaupt nicht. Dass die Flüchtlinge ausgebeutet werden, dass ihre prekäre Lage und Illegalität ausgenutzt wird, wissen sie. Aber was sie dort verdienen, ist immer noch mehr als zu Hause. Während die US-Regierung also die illegale Einwanderung im Sinne ihrer Wähler bekämpft, profitieren Landwirtschaft und Industrie eigentlich davon.
Koka- und Kaffeeanbau
Die Wurzeln der Probleme in Mittelamerika reichen zurück in die Bürgerkriege der letzten Jahrzehnte in fast allen diesen Staaten und auch in Südamerika. Militärregierungen führten blutige und verlustreiche Kriege gegen linke Guerillas. Viele ehemalige Guerillas sind heute Kriminelle. Hinzu kommt die überall gegenwärtige Korruption, deren Bekämpfung in Staat und Gesellschaft sich fast jede neue Regierung auf ihre Fahnen schreibt, die allerdings in der Praxis kaum umzusetzen ist. Kokain wird aus Südamerika über Mittelamerika und Mexiko in die USA und andere Staaten geschmuggelt. Drogenkartelle in Mexiko, kriminelle Organisationen in Honduras, Guatemala und El Salvador arbeiten zusammen und haben Polizisten, Beamte und Politiker auf ihren Gehaltslisten. Sie sind Staaten im Staate, und wer ihre Kreise stört, wird ausgeschaltet. Die Mordraten in Mexiko und einigen Staaten Mittelamerikas gehören zu den höchsten der Welt. Die Kartelle schmuggeln ebenso Waffen, exotische Tiere, betreiben Kinderhandel und schleusen Migranten.
Der Klimawandel mit seinen Veränderungen, darunter Hurrikans, trifft gerade die mittelamerikanischen und karibischen Staaten besonders hart. Einige Länder der Region werden jährlich mehrfach durch extreme Wettererscheinungen wie Wirbelstürme getroffen. Wirtschaftlich ohnehin relativ schwach oder schlecht aufgestellt, haben sie größte Schwierigkeiten, die Schäden und deren Folgen zu beseitigen beziehungsweise aufzufangen. Die andere Seite sind Dürren und die Erwärmung, die beispielsweise den Kaffeeanbau ganz erheblich beeinträchtigen. In Honduras, Guatemala, Mexiko, Nicaragua und Costa Rica leben Millionen Menschen vom Kaffeeanbau. Doch in den vergangenen Jahren haben die klimatischen Veränderungen zu erheblichen Ertragseinbrüchen geführt. Es ist zu warm und trocken, sodass der Kaffeeanbau eigentlich in höhere, kühlere und feuchtere Regionen ausweichen müsste. Doch das ist für die meisten Bauern keine realistische Lösung.
Costa Rica, in vielerlei Hinsicht Vorreiter in Mittelamerika, versucht die Klimakrise mit Schattenkaffeeplantagen abzumildern. Der Anbau im Schatten von Bäumen schützt den Boden unter anderem vor übermäßiger Erosion und Verdunstung und senkt die Bodentemperatur. Das sind Lösungsmöglichkeiten, die Geld und vor allem viel Zeit beanspruchen. Sie kommen für viele Bauern in ihrer existenziellen Notlage nicht mehr infrage.
US-Politik: Zuckerbrot und Peitsche
Das aggressive Vorgehen der Trump-Administration, die sich dabei über Recht und Gesetz hinwegsetzt und richterliche Entscheide missachtet, sowie massive Drohungen gegenüber lateinamerikanischen Staaten begleiteten die Reise von US-Außenminister Marco Rubio Anfang Februar nach Mittelamerika. Er besuchte Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala und die Dominikanische Republik und trat dort mit Zuckerbrot und Peitsche auf. Rubio versuchte den Staatsführern klar zu machen, was Amerika unter Präsident Trump von ihnen erwartet. Dazu gehört die Bekämpfung von Migration, Drogenhandel und Kriminalität insgesamt – und natürlich die Gefolgschaft zur Eindämmung Chinas. Die kleinen zentralamerikanischen Staaten können den Forderungen aus Washington nichts entgegensetzen.
Das zeigte sich schon bei Panama angesichts der mächtigen Drohkulisse, die Trump aufgebaut hatte. Dort, wie in Costa Rica, der Dominikanischen Republik und El Salvador, ging es bei den Gesprächen mit Rubio immer auch um Migration und darum, wie sie unterbunden werden kann. El Salvador ließ sich sogar dazu herab, Washington anzubieten, in den USA verurteilte Kriminelle in El Salvador ins Gefängnis zu stecken. Solches Entgegenkommen ist natürlich ganz im Sinne von Trump.
Chinas Einfluss wächst
In Mittelamerika spielt die wirtschaftliche und geostrategische Rivalität zwischen den USA und China eine zunehmende Rolle. Für Washington bedeutet das Engagement Pekings in Mittelamerika den Einbruch in eine Großregion, welche die USA als ihren Vorhof ansehen. Die Tatsache, dass Taiwan hier noch Unterstützung und Anerkennung findet, hat Peking auf den Plan gerufen. China versucht im Rahmen der „Ein-China-Politik“ (es gibt nur ein „China“, das neben dem von der Volksrepublik kontrollierten Festlandchina auch die Republik China auf Taiwan umfasst) die Staaten zu erpressen, damit sie die Beziehungen zu Taiwan kappen und die diplomatische Anerkennung von Taiwan fallen lassen. Chinas handels- und wirtschaftspolitische Angebote oder aber der Entzug seiner Gunst, haben in den vergangenen Jahren Wirkung gezeigt. Costa Rica, Panama, El Salvador und Nicaragua konnten „überzeugt“ werden, die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abzubrechen.
Standhaft geblieben sind bislang Belize, Guatemala und Honduras, die zu den wenigen Staaten weltweit gehören, die noch Botschaften in Taiwan und umgekehrt Taiwans in ihren Ländern unterhalten. Das belohnt Washington, erwartet aber auch hier Mitarbeit bei der Eindämmung von Migration und Drogenschmuggel.
Die USA haben mit Trumps Regierungsantritt und seinen Drohungen gegenüber Panama erreicht, dass Panama China zumindest aus den beiden wichtigen Häfen beiderseits des Panamakanals hinausgeschmissen hat. Die USA wollen China ganz vom Kanal fernhalten, der für sie von höchster strategischer Bedeutung ist. Dafür müsste Washington den zentralamerikanischen Staaten eigentlich entsprechende Angebote machen, wenn es nicht für weiteren Frust und wirtschaftliche Nachteile sorgen will. Ähnlich wichtig wie der Panamakanal dürfte in den kommenden Jahren die zunehmend eisfrei werdende Nordwest-Passage im Norden um Kanada herum werden.
Fluchtursachen bekämpfen
Obwohl die Mittel knapp sind, versuchen Mexiko und einige zentralamerikanische Länder die Ursachen der Fluchtbewegungen abzumildern oder zu beseitigen und Flüchtende zur Umkehr zu bewegen. In Mexiko sollen bislang benachteiligte und vor allem sehr stark von der Landwirtschaft abhängende Bundesstaaten stärker gefördert werden. In Honduras geht es um langfristige Perspektiven für die Menschen, die zurückkehren. Doch die Mittel sind begrenzt, und die Regierungen und entsprechende lokale und regionale Organisationen hoffen auf die Unterstützung der Vereinten Nationen für solche Rückkehrprogramme. Erfolg und Misserfolg dürften auch von UN-Zahlungen abhängen. Doch Kürzungen der US-Gelder für Hilfsorganisationen und das Aus der USAID-Hilfen sprechen eine andere Sprache.
JÜRGEN RAHMIG ist seit 40 Jahren Zeitungsredakteur mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik sowie Verfasser von Büchern zum politischen Zeitgeschehen. Er berichtet aus Krisengebieten und ist seit 25 Jahren regelmäßig auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu Gast. In seinem Buch „Der Kampf ums Wasser“ (S. Hirzel Verlag) beleuchtet Jürgen Rahmig die Konflikte rund um die Ressource Wasser im 21. Jahrhundert.