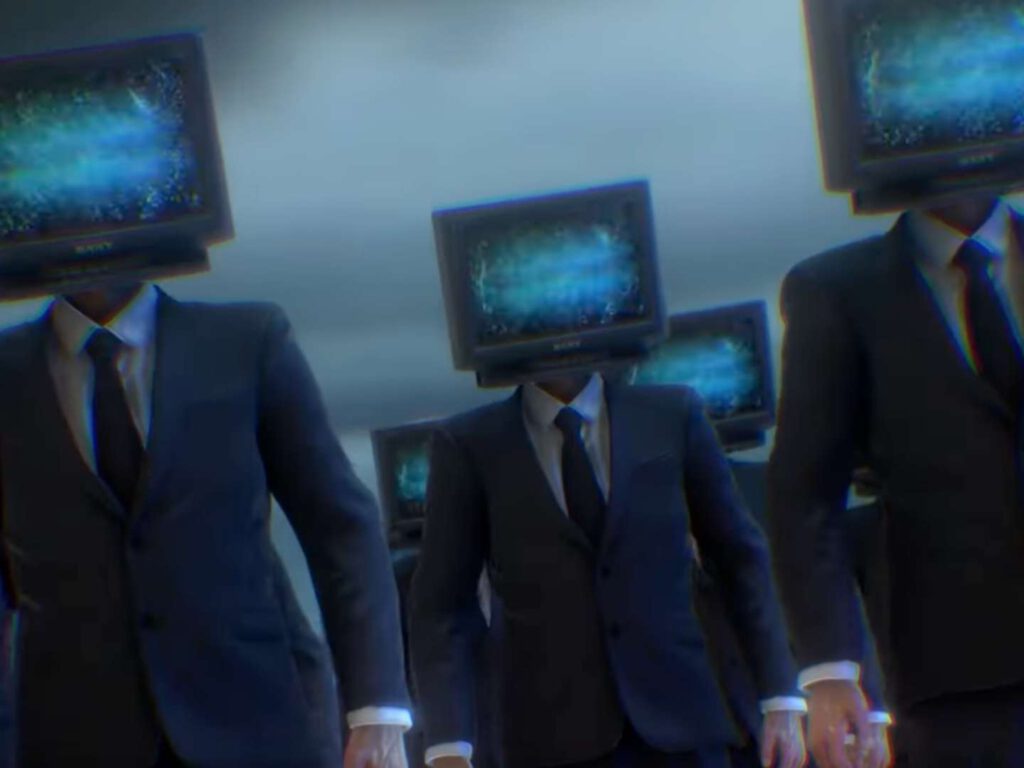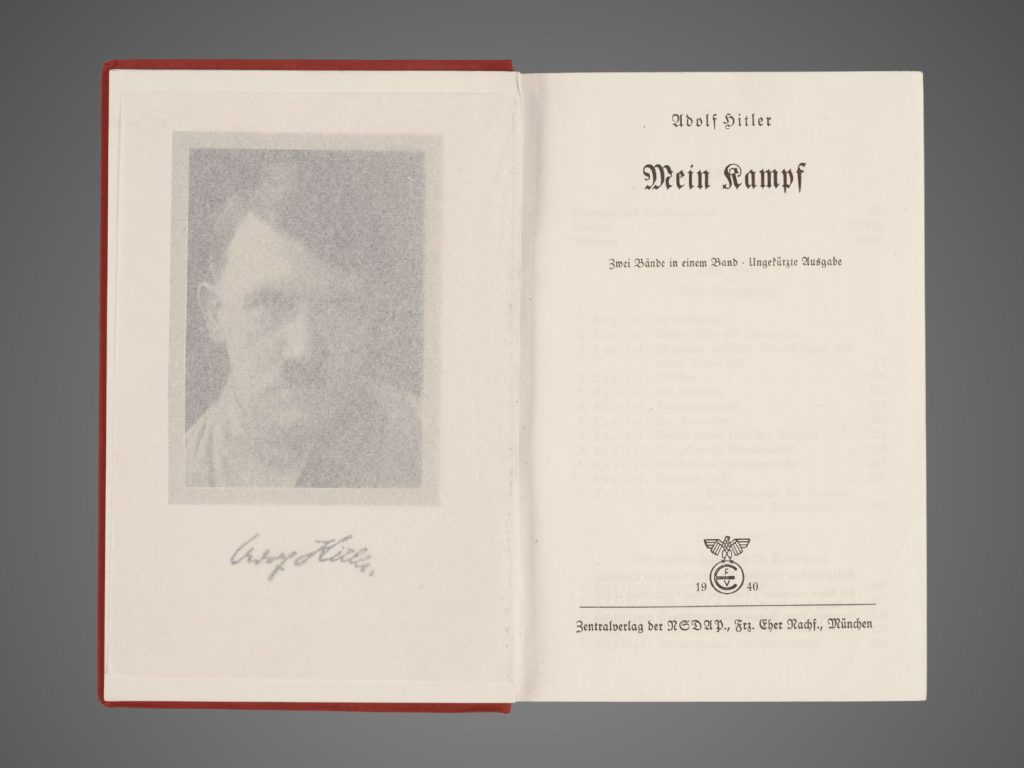25 Jahre Sturz des Milošević-Regimes – inmitten der aktuellen Proteste in Serbien
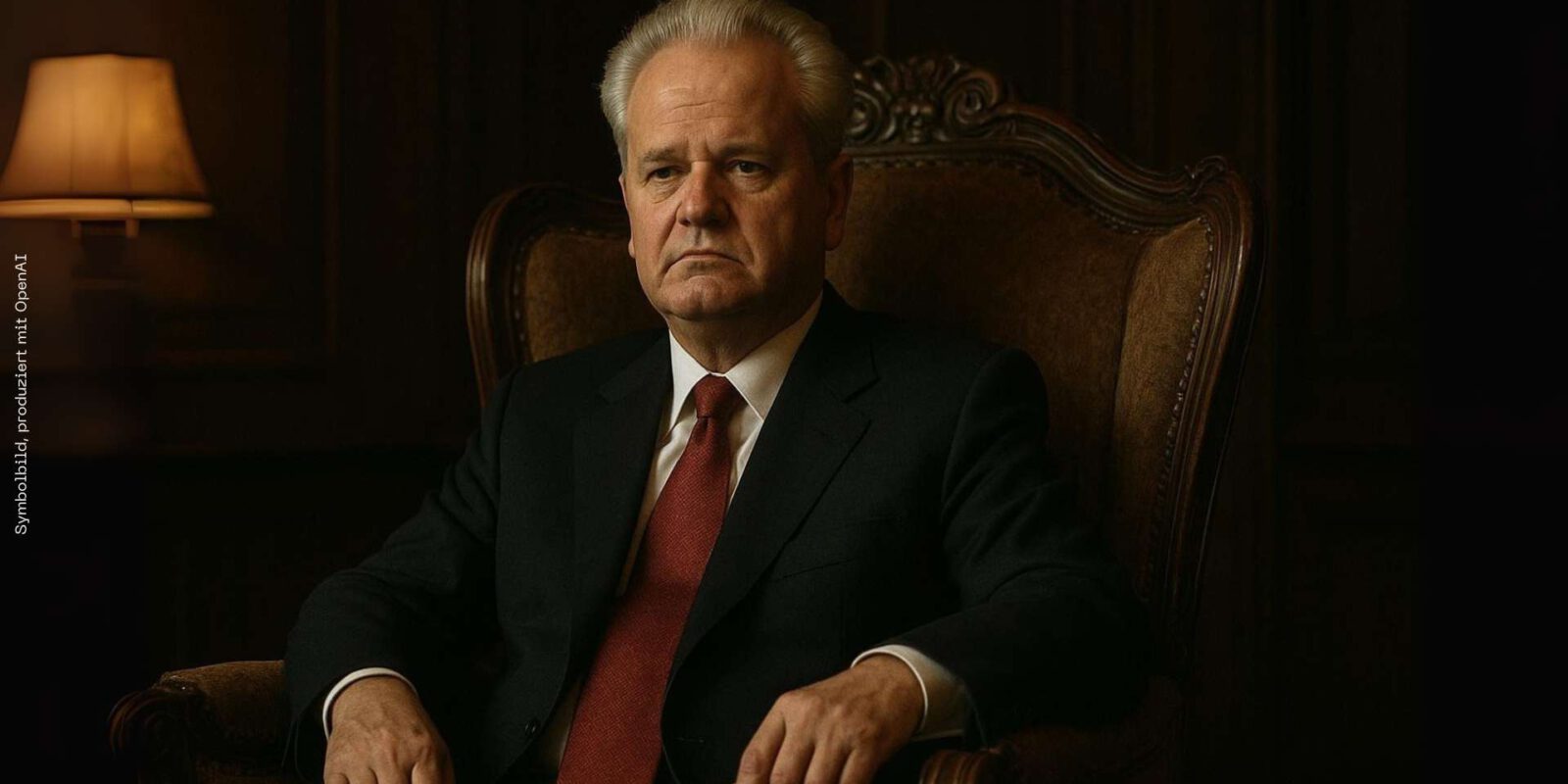
Am 5. Oktober 2000 beendete ein Volksaufstand in Serbien die Willkürherrschaft von Slobodan Milošević. Jetzt, 25 Jahre später, halten die monatelangen Proteste gegen den amtierenden Präsidenten Aleksandar Vučić unvermindert an. Doch dieser klammert sich an die Macht. Jetzt ist kluge EU-Politik gefragt.
Die stimmungsgewaltigen Bilder von der Belgrader Massendemonstration am 5. Oktober 2000 gingen um die Welt. Der Sturz des Milošević-Regimes war vollzogen. Der Tag der Befreiung, der „peti oktobar“, hallte lange nach – ohne jemals mit einer offiziellen Feierlichkeit bedacht zu werden. Die darauffolgende proeuropäische Regierung unter Zoran Đinđić kam schon bald ins Tun, denn endlich erschien der Weg in Richtung EU-Beitritt in Reichweite.
Doch bis dahin war es ein langer Weg. Ein Rückblick:
1980er Jahre: Milošević und der serbische Ethnonationalismus
Sind die staatlichen Institutionen schwach, spielt sich das politische Leben in anderen, nämlich parastaatlichen Räumen ab, so auch auf der Straße. Das wusste der aufstrebende Karrierist Slobodan Milošević für sich zu nützen. In den späten 1980er Jahren waren viele Menschen im Zuge der jugoslawischen Wirtschaftskrise unzufrieden und gingen deshalb auf die Straße. Milošević kanalisierte diese Unzufriedenheit und lud sie ethnonationalistisch auf: Er behauptete, das sogenannte serbische Volk wäre in Jugoslawien diskriminiert. Dabei bezog er sich auf das „Großserbische Memorandum“, ein skandalumwittertes Dokument der Serbischen Akademie der Wissenschaften (SANU) von 1986. Mit seiner rechtspopulistischen Position fand er Gefolgsleute im serbischen Bund der Kommunisten, wo man ihn 1987 zum Vorsitzenden wählte.
Während sich der Bund der Kommunisten auf höchster Ebene über die Zukunft Jugoslawiens nicht einigen konnte – ob Bundesstaat oder Staatenbund (sogar ein möglicher EG-Beitritt wurde kurz diskutiert) –, begann man in Serbien unter Milošević wichtige Positionen im öffentlichen Dienst mit loyalen Gefolgsleuten zu besetzen und bürgerliche Rechte zu beschneiden.
Ethnische Minderheiten bekamen dies als Erste spüren, etwa die albanische Bevölkerung im Kosovo. Das alles geschah unter dem Schirm ethnonationalistischer Folklore. Heraufbeschworen wurde der serbische Opfermythos, also der alte Kosovomythos von der verlorenen Schlacht auf dem Amselfeld 1389 und der darauffolgenden osmanischen Fremdherrschaft. Die nationalistisch-klerikal aufgeladene 600-Jahr-Feier am 28. Juni 1989 entpuppte sich als propagandistische Massenveranstaltung.
Der ethnonationalistische Zeitgeist erfasste bald alle jugoslawischen Teilrepubliken. Die Sezessionsbestrebungen in Slowenien und Kroatien nahmen ihren Lauf. Der Zerfall Jugoslawiens stand bevor.
1991: Mit Panzern gegen Demonstrationen
Inmitten der ethnonationalistischen Hetze machte sich in Serbien oppositioneller Unmut breit, der sich ebenfalls auf der Straße entlud, weil Massenmedien staatlich kontrolliert und folglich Meinungs- und Pressefreiheit eingeschränkt waren. Gesetzlich gab es zwar das Mehrparteiensystem seit 1990, jedoch waren Oppositionspolitiker:innen weitgehend unbekannt, weil von Massenmedien ausgeschlossen.
Gegen dieses Informations- und Medienmonopol des Milošević-Regimes mobilisierte der Schriftsteller und damals populärste Oppositionspolitiker Vuk Drašković, Chef der nationalistisch-monarchistischen SPO (Serbischen Erneuerungsbewegung).
Am 9. März 1991 versammelten sich etliche Regierungskritker:innen auf dem Belgrader Platz der Republik (Trg Republike). Mit Gewalt und Tränengas wurde diese erste Großdemonstration niedergeschlagen. Noch vor Ausbruch der jugoslawischen Zerfallskriege füllten Panzer der Jugoslawische Volksarmee (JNA) die Straßen Belgrads.
Jugowlawien-Kriege: Ablenkung von inneren Konflikten
Die Strategie, durch äußere Kriege innere Konflikte zu befrieden bzw. zu unterdrücken, war bis Mitte der 1990er Jahre erfolgreich. Nach dem kurzen Slowenienkrieg wütete der Kroatienkrieg von 1991 bis 1995, der Bosnienkrieg von 1992 bis 1995. Die zwar gut besuchten, jedoch marginalisierten oppositionellen Antikriegs- und Studierendenproteste tangierten die serbische Machtelite kaum.
Das änderte sich nach Abschluss des Friedensvertrags von Dayton im Dezember 1995. Dieser beendete einerseits den Krieg in Bosnien und Herzegowina und erteilte andererseits dem nationalistischen Traum einer Vereinigung aller Serb:innen eine klare Absage. Nicht alle in Serbien waren damit zufrieden. Das bot den nächsten Protesten einen gewissen Nährboden.
1996/97: Erfolgreiche Proteste gegen Wahlmanipulation
Zu den bis dahin größten Protesten kam es infolge von Wahlmanipulationen bei den Gemeindewahlen im November 1996. Die in vielen Gemeinden eigentlich als Siegerin hervorgegangene, jedoch nicht als solche anerkannte oppositionelle Koalition „Zajedno“ (Gemeinsam) initiierte die Proteste. An deren Spitze standen zunächst die drei Parteichef:innen Vuk Drašković (SPO), Vesna Pešić (Bürgerliche Bewegung Serbiens, GPS) und Zoran Đinđić (Demokratische Partei, DS). Sehr bald entwickelte sich aber eine Eigendynamik. So breiteten sich die parallel laufenden Bürger:innen- und Studierendenproteste erstmals auf 15 Städte aus und hielten im Fall der Erstgenannten durchgehend 88 Tage bzw. im Fall des Studierendenprotests 115 Tage an.
Zu den zentralen Forderungen zählten die Anerkennung der Wahlergebnisse, eine Liberalisierung des Mediensystems und eine Verbesserung existenzieller Lebensbedingungen, die sich im Zuge der Kriege und UN-Sanktionen massiv verschlechtert hatten.
Humor wurde zum wichtigsten Artikulationsmedium der Protestierenden, die sich jeden Tag neue Aktionen ausdachten. Besonders die Studierendenproteste als Ausdruck einer neuen hoffnungsvollen Generation stießen auf breite Zustimmung.
Zu Konflikten kam es ausschließlich mit Polizeieinheiten, nachdem die Armeeführung unter Verweis auf den Protest vom 9. März 1991 (siehe oben) ihr Einschreiten verweigerte. Als sich sogar die serbisch-orthodoxe Kirche auf die Seite der Studierenden stellte, kam die Staatsspitze nicht mehr aus, die zentralen Forderungen zu erfüllen, nämlich die Wahlergebnisse zu akzeptieren.
Ein jähes Ende fanden die einst euphorischen Studierendenproteste, als sich die oppositionelle Zajedno-Koalition zerstritt, und zwar wegen regimenaher Kollaboration.
1999: Ausnahmezustand unter den NATO-Bombardements
Während sich in Serbien viele Oppositionelle, vor allem Studierende, von der Politik enttäuscht abwandten, forcierte das Milošević-Regime seinen nächsten und letzten äußeren Konflikt, den Kosovo-Krieg, der durch die 78-tägigen NATO-Bombardements 1999 auf die Bundesrepublik Jugoslawien beendet wurde. Damit kam der Krieg sozusagen erstmals nach Serbien, was eine bisher diffuse Unzufriedenheit manifest werden ließ, und zwar darüber, dass das Milošević-Regime jeden begonnenen Krieg aus serbisch-nationalistischer Perspektive verloren hatte, Friedensverhandlungen scheitern ließ und folglich nicht in der Lage war, die eigene Bevölkerung vor einem internationalen Angriff zu schützen.
Unter dem durch die – übrigens völkerrechtlich umstrittenen – NATO-Bombardements ausgerufenen Ausnahmezustand wurde jegliches oppositionelle Handeln nahezu unmöglich gemacht und Medienarbeit rigider Zensur unterstellt. Dafür sorgte der damalige Informationsminister Aleksandar Vučić. Er war es auch, der 1998 das bisher restriktivste Medien- und Universitätsgesetz erließ. Das war wiederum Anlass für die Gründung der studentischen Widerstandsbewegung OTPOR, die sich die Erfahrungen von 1996/97 (siehe oben) zunutze machen konnte.
Zwar hielt sich OTPOR während der NATO-Bombardements bedeckt, jedoch konnte es die wachsende Unzufriedenheit der Menschen für sich nutzen. Nach dem Einlenken des Milošević-Regimes auf internationaler Ebene entwickelte sich OTPOR (symbolisiert durch eine Graffiti-Faust) zur zentralen Oppositionsbewegung. Mit erfrischendem Witz, gut geplanten Aktionen und gut durchdachter Organisationsstruktur erfreute sich diese Widerstandsbewegung regen Zulaufs – auch mithilfe internationaler Unterstützung. Mittlerweile war das Milošević-Regime finanziell bankrott und international völlig isoliert. Genau das war der Moment für die liberaldemokratische Opposition.
Der 5. Oktober 2000 als oppositioneller Befreiungsschlag
Angesichts der jugoslawischen Präsidentschaftswahlen am 24. September 2000 konnten sich die ansonsten zutiefst zerstrittenen Oppositionsparteien auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen, Vojislav Koštunica. Die oppositionellen Wahlkampagnen liefen auf Hochtouren, sodass der bis dahin relativ unbekannte und dadurch quasi unbefleckte Gegenkandidat erstmals als geeignete Alternative zu Milošević erschien.
Gewählt wurde nicht primär für Koštunica, sondern gegen Milošević – daher der Slogan „Fertig ist er!“ („Gotov je!“). Als Milošević den Sieg seines Herausforderers nicht anerkennen, sondern stattdessen Neuwahlen ausrufen wollte, formierte sich eine bis dahin historisch einzigartige Protestbewegung. 200.000 Menschen aus ganz Serbien versammelten sich am 5. Oktober in Belgrad, um in einer riesigen Straßendemonstration den Wahlsieg des Herausforderers zu untermauern und Neuwahlen zu verhindern.
Damit dieser damals historische Massenprotest nicht in Gewalt ausartete, mussten zuvor entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. Eine wesentliche Grundlage bot der Umstand, dass das Milošević-Regime infolge von Kriegen, Sanktionen und Misswirtschaft keine finanziellen Mittel mehr hatte, den Staatsapparat aufrechtzuerhalten. Es fehlte nicht zuletzt das Geld für die Gehälter von Staatsbediensteten, was wenig überraschend die Loyalität der Betroffenen schwinden ließ. Vor diesem Hintergrund erschien es nicht schwer, die notwendige Vorbereitung zu treffen.
Am Vortag des Regimewechsels, dem 4. Oktober 2000, trafen sich der oppositionelle DS-Chef Zoran Đinđić und Milorad Ulemek Legija, Leiter der serbischen Spezialeinheit „Rote Baretten“, heimlich in einem Jeep. Bei diesem Geheimtreffen vereinbarten die beiden, dass die Spezialeinheit nicht eingreifen und es dadurch zu keinem Blutvergießen kommen werde.
Am Tag des Umsturzes selbst schlugen sich Vertreter von Polizei und Armee auf die Seite der Demonstrant:innen. Ohne den Gewaltapparat konnte Milošević seine Vorherrschaft nicht mehr aufrechterhalten und musste letztlich den Wahlsieg Koštunicas anerkennen.
Eine neue hoffnungsvolle, proeuropäische Ära begann – allerdings nur auf den ersten Blick.
Kein Systemwechsel: Warum der „6. Oktober“ fehlt
Der 5. Oktober 2000 markiert einen Regimewechsel, jedoch keinen Systemwechsel. Die darauffolgenden Parlamentswahlen im Dezember 2000 brachten zwar den Sieg der neuen liberaldemokratischen DOS-Regierung unter Premier Zoran Đinđić, jedoch keinen Austausch von Politiker:innen. Diese wurden nämlich in Serbien rechtlich nicht zur Verantwortung gezogen. Alle, die nicht wegen Kriegsverbrechen angeklagt waren, konnten weiterhin politisch tätig sein. So verschwanden Protagonisten des einstigen Milošević-Regimes wie eben Aleksandar Vučić nicht von der Bildfläche.
Am 12. März 2003 fiel der Premier Zoran Đinđić einem Attentat zum Opfer. Milorad Ulemek Legija wurde als Drahtzieher dieses Attentats zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Viel mehr ergaben die Ermittlungen nicht. Dass eben der sogenannte 6. Oktober, als Metapher für den notwendigen Systemwechsel, fehle, wurde in den Anfangsjahren des neuen Regimes häufig debattiert.
In Zeiten von Vučićs Stabilokratie seit dessen Regierungseintritt 2012 und Präsidentschaft seit 2017 erscheint eine derartige Diskussion marginalisiert. Der Aufstand wütender Bürger:innen und Studierender ist mittlerweile weit größer, der regimetreue Staatsapparat jedoch stabiler als noch während der 1990er Jahre, und zwar mithilfe von Putins strategischer Unterstützung, chinesischer Technologie, korrupter Wirtschaft sowie mafiöser Strukturen.
2024/25: Die (Ohn-)Macht der aktuellen Proteste
Seit November 2024 laufen in Serbien wieder anhaltende Proteste gegen Korruption, Machtmissbrauch der Regierung und den autoritären Führungsstil von Präsident Aleksandar Vučić. Ihren vorläufigen Höhepunkt haben die Proteste am 15. März 2025 erreicht, als ungefähr 300.000 Menschen aus ganz Serbien nach Belgrad strömten, also mehr als noch am 5. Oktober 2000.
Die Forderungen der Demonstrant:innen nach Medienfreiheit, Rechtsstaatlichkeit, einem Ende der Korruption und fairen Parlamentswahlen lehnt der Präsident dezidiert ab. Stattdessen wird zunehmend brutale Gewalt gegen die Demonstrierenden eingesetzt.
Beim Vergleich dieser aktuellen Proteste mit jenen der 1990er Jahre fällt ein wichtiger Unterschied auf. Die Position der internationalen Gemeinschaft gegenüber dem Kriegstreiber Slobodan Milošević war zwar nicht durchgehend einheitlich, dennoch war dieser infolge von Kriegen und UN-Sanktionen international weitgehend isoliert.
Vučić hingegen ist im EU-Kandidatenland Serbien international bestens vernetzt, von Brüssel und Washington bis Moskau und Beijing. Jahrelang fälschlicherweise als Pro-Europäer hofiert, kokettiert der serbische Stabilokrat mit einem sogenannten dritten Weg, d.h. einen Zickzack-Kurs zwischen Brüssel und Moskau.
MEP Helmut Brandstätter zählt zu den ersten Politiker:innen auf EU-Ebene, die Vučić offen aufgerufen haben, sich zwischen Brüssel oder Moskau zu entscheiden. Auch diskutiert man gerade innerhalb der Europäischen Volkspartei (EVP), Vučićs SNS auszuschließen – aus Gründen der problematischen Russlandnähe wie auch Menschenrechtsverletzungen im Zuge der aktuellen Studierenden- und Bürger:innenproteste.
Die europäische Verantwortung
Nicht nur Vučić auf der einen Seite, sondern auch die liberaldemokratische Opposition auf der anderen Seite haben Lehren aus dem 5. Oktober 2000 gezogen – mit jeweils gegensätzlichen proeuropäischen oder umgekehrt antidemokratischen Schlüssen. Auch auf europäischer Ebene sollte man tunlichst vermeiden, die Fehler der 2000er Jahre zu wiederholen. Zu lange sitzt Serbien neben den anderen Westbalkanstaaten im EU-Warteraum. Die Anziehungskraft eines EU-Beitritts ist deutlich verblasst.
Geschwungen werden bei den Demonstrationen ausschließlich serbische, nicht europäische Flaggen, wie auch Marta Kos, EU-Erweiterungskommissarin bemerkt hat. Der Hoffnung scheinen schon längst Enttäuschung und Trotz gefolgt zu sein. Dagegen gilt es gerade jetzt, den Austausch mit liberaldemokratischen und proeuropäischen Kräften zu fördern. Protestieren doch mitunter die Kinder jener Studierender, die noch 1996/97 demonstriert hatten.
Schon längst stellt sich die Frage, wie ein solches Blueprint aussehen könnte und wie ein EU-Beitritt Serbiens und aller WB6-Staaten und EU-Kandidatenländer unter liberaldemokratischen Voraussetzungen endlich abgeschlossen werden könnte. Denn Geopolitik kennt kein Vakuum, wie NEOS-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger weiß. Daher dürfe man beim – wohlgemerkt rechtsstaatlich konformen – EU-Erweiterungsprozess nicht noch mehr Zeit vergeuden. Darin stimmen alle proeuropäischen Kräfte überein. Schließlich fordert die geopolitische Situation jetzt, wie allseits bemerkbar, eine dringlichere Vorgehensweise als noch vor 25 Jahren.