Der Gazakonflikt-Terror-Nexus und die TikTok-Radikalisierung in Europa
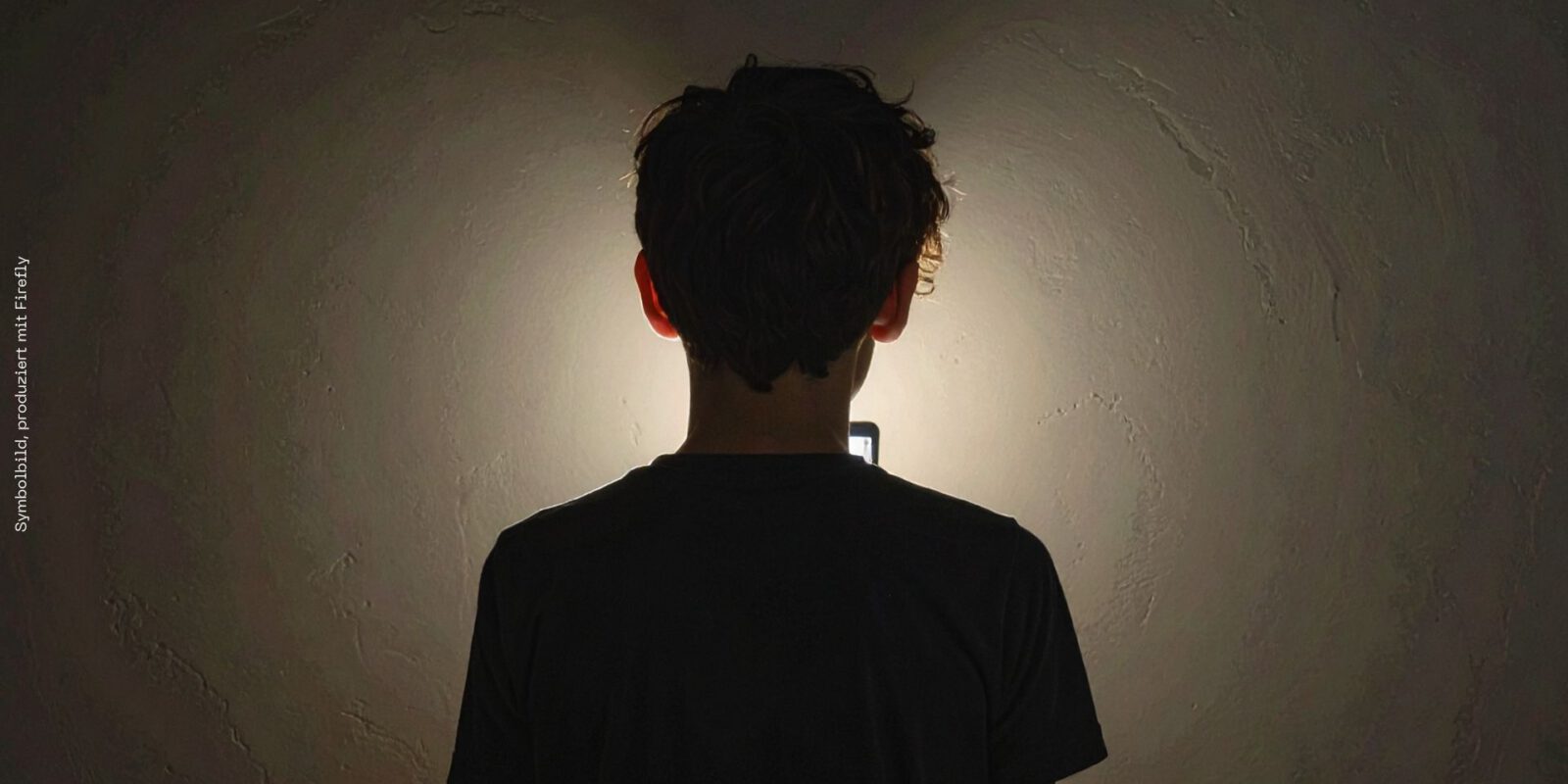
Der terroristische Angriff der Hamas gegen Israel am 7. Oktober 2023 markiert nicht nur eine geo- und sicherheitspolitische Zäsur, sondern hat auch eine radikale Verschiebung bei extremistischen Kommunikations- und Mobilisierungsstrategien bedingt – insbesondere in islamistischen sowie teilweise auch rechts– und „antiimperialistisch“-linksextremistischen Milieus.
Das Phänomen des „Konflikt-Terror-Nexus“ beschreibt den Zusammenhang zwischen transnationalen Konfliktdynamiken – etwa im Nahen Osten – und direkt darauf Bezug nehmenden terroristischen Mobilisierungs-, Radikalisierungs- und Rekrutierungsprozessen, beispielsweise in Europa. Digitale Social-Media-Plattformen wie TikTok oder Messengerdienste wie Telegram spielen dabei mittlerweile eine zentrale Rolle, da sie den emotionalisierten Narrativen kurzfristig eine enorme Reichweite verschaffen. Dies geschieht mittels Schockbildern aus Gaza, trivialisierenden Opferdiskursen oder plumper Verherrlichung.
Ansprechbare Jugendliche (im gewaltbereiten Segment oftmals junge Muslime mit Migrationshintergrund) in Europa werden unmittelbar in diese zugespitzten narrativen Deutungskämpfe hineingesogen. Eine direkte Konsequenz ist angebotsseitig eine dramatische Zunahme an extremistischem, insbesondere antisemitischem Content. Seit rund zwei Jahren kursiert im virtuellen Informationsraum ein enorm breites Angebot an islamistischer Propaganda und einschlägigen extremistischen Botschaften. Über beliebte Webapplikationen wie TikTok, YouTube, Reddit u.v.a. gelangt das Material ungefiltert auf die Handys europäischer Jugendlicher. Auch die Nachfrage nach entsprechenden problematischen Inhalten ist seit Oktober 2023 zusehends größer geworden.
Der Konflikt-Terror-Nexus
Im Zentrum des Nexus steht eine immer stärker werdende, von extremistischen Akteuren instrumentalisierte Gaza-Propaganda. Man hat den Eindruck, als wollten „alle“ auf den Zug aufspringen. Islamisten von salafistischen Influencer-Predigern bis hin zu dschihadistischen Gruppen als auch links- bzw. rechtsextreme Akteure adaptieren Bilder – authentisch oder fake – und Narrative des Konflikts, um Feindbilder zu verstärken. Die Zielsetzung: die Mobilisierung bzw. Rekrutierung von potenziell gewaltbereiten (vorwiegend) Teenagern zu erleichtern. Die Hamas inszenierte ihren Angriff wenig überraschend als „Widerstand gegen unrechtmäßige Besatzung“, während dschihadistische Netzwerke diesen mittlerweile als Bestätigung ihres globalen Kampfes gegen die Ungläubigen deuten. Parallel hierzu nutzen rechtsextreme Milieus die Gewaltbilder, um antisemitische Verschwörungsmythen zu befeuern.
In linksextremistischen Zirkeln wird unter dem Siegel des Postkolonialismus ein Befreiungskampf Palästinas gegen den „illegalen Okkupanten“ Israel – auch unter dem Banner der Anklage eines Völkermords – stilisiert. Dies ist in hohem Maße anschlussfähig bei Islamisten in sämtlichen Schattierungen, zumal das Existenzrecht Israels dadurch indirekt oder direkt infrage gestellt wird. Diese wechselseitige Aufladung unter der Parole „from the river to the sea“ verschärft jedenfalls die gesellschaftliche Polarisierung in Europa und erzeugt ein bedrohliches, ideologisch unterwandertes Resonanzfeld. In einem solchen kann extremistische Gewalt als legitimes Mittel politischer Kommunikation interpretiert werden.
Antisemitismus als Katalysator
Eine zentrale ideologische Konstante, die mittlerweile sowohl islamistische als auch links- und rechtsextreme Narrative verbindet, ist ein kruder, unverstellter Antisemitismus, der wieder salonfähig geworden zu sein scheint. Er fungiert als verbindende Klammer zwischen unterschiedlichen weltanschaulichen Milieus und schafft gemeinsame Wirkungsräume für politisch bzw. religiös motivierten Hass, Verschwörungserzählungen und eine paradoxe Gewaltlegitimation. Eine konstruierte Opfererzählung, die auf eine homogenisierte Gesamtgruppe (zum Beispiel „die Muslime“) ausgeweitet wird. Im Zentrum dieser Opfersemantik steht die Schuldzuschreibung gegenüber einem ebenfalls homogenisierten Feindbild („die Juden“). Islamistische Extremisten, insbesondere gewaltorientierte Dschihadisten, bauen ihre Rechtfertigung gewaltsamer Übergriffe gegen Juden auf antisemitischen Diskursen und Stereotypen auf. In der dschihadistischen Ausprägung deuten sie den Nahostkonflikt in und rund um Gaza geopolitisch als Kampf gegen ein angeblich „zionistisches“, von „willfährigen“ westlichen Unterstützern forciertes „Weltsystem“. Rechtsextreme Gruppen propagieren „traditionelle“ antisemitische Weltverschwörungserzählungen. Linksextremisten suchen indes „post- oder antikoloniale“, anti-zionistische Stereotype in die Gegenwart zu übertragen.
Sämtliche Extremisten nutzen vor allem die gewaltsamen Ausprägungen des Konflikts als Beleg für ihre jeweiligen Ressentiments. Durch die mediale Omnipräsenz von schockierenden Gräuelbildern aus Gaza und anhaltender Kritik an Israels Kriegsführung erhält Antisemitismus regelmäßig neuen Auftrieb. In sozialen Netzwerken wird dies als vermeintlich legitime Kritik an politischen Zuständen bzw. an Israel und dessen Kriegsführung und demgemäß als „bloßer“ Antizionismus verschleiert. Man lese etwa beliebige Chat- und Kommentarspalten unterhalb von Zeitungsartikeln, die das Thema „Gaza“ sogar nur peripher anschneiden. Hassrede ist, so scheint es, permanent an der Tagesordnung, und Content-Moderatoren haben alle Hände voll zu tun, selbige vom Netz zu holen bzw. gar nicht erst zuzulassen. Damit verstärkt sich unverhohlen die Gefahr, dass antisemitische Deutungen als Katalysator für spätere Gewaltakte dienen können. Sei es in Form von Vandalismusakten gegen jüdische respektive israelische Einrichtungen oder durch stochastische Gewalt gegen zufällig gewählte Opfer mit realem oder zugeschriebenem jüdischem Hintergrund. Sichtbar etwa beim (versuchten) Anschlag eines 18-jährigen Salzburgers auf das israelische Generalkonsulat in München am 5. September des Vorjahres – am Tag des Gedenkens zum Olympia-Attentat von 1972, bei dem der Attentäter in einem Schusswechsel mit der Exekutive getötet wurde.
Digitale Radikalisierung auf TikTok & Co.
TikTok hat sich neben RocketChat vor allem in den letzten fünf Jahren zur Schlüsselplattform islamistischer Online-Propaganda entwickelt. Ihre spezifischen Mechanismen – algorithmische Verstärkung, kurze Videos, visuelle Emotionalisierung – verstärken die Suggestivkraft von Gewaltbildern. Prägnante 40 Sekunden lange Clips aus Gaza, oft mit religiösen Bezügen oder dschihadistischer Symbolik, binden besonders junge Nutzer an Deutungen, die Ungerechtigkeit, Opferrollen und Rache betonen. Und gleichzeitig ebenso legitimieren. Durch die algorithmisch gesteuerte Wiederholung extremer Inhalte stumpfen Nutzer in sozialen Medien zunehmend ab. Inhalte, die Nutzer sozialer Medien regelmäßig online konsumieren, können als normal wahrgenommen werden, selbst wenn sie in anderen Zusammenhängen als inakzeptabel oder unpassend empfunden werden. Zudem gibt es aufgrund des Algorithmus eine Art Filterblasen-Effekt, wo Usern immer wieder ähnliche Inhalte und Positionen in neuem Gewand angeboten werden.
Rezente Untersuchungen zeigen, dass terroristische Einzeltäter in Europa seit Oktober 2023 zunehmend über TikTok (vorwiegend) online radikalisiert wurden. Dort trafen sie auf Gleichgesinnte, Inspiration und Bestätigung sowie durch Plattformmigration in verschlüsselte Kommunikationskanäle fanden sie ebenso entsprechende Handlungsanleitungen. Der anhaltende Transfer der Mobilisierungsinhalte in verschlüsselte Kommunikationskanäle wie Telegram erschwert die Detektion. Während Plattformen wie TikTok und Instagram zur massenhaften Erstverbreitung und emotionalen Aufladung eines breiteren Publikums dienen, verlagern sich tiefergehende Interaktionen, persönliche Vernetzungen und operative Planungen in geschlossene, schwer zugängliche digitale Räume, vorwiegend in den Bereich der verschlüsselten Messengerdienstkommunikation. Dort werden extremistische Inhalte ideologisch verdichtet und in Handlungsanleitungen für potenzielle Attentäter verwandelt. Eine vermehrt zu beobachtende Methode ist die Verlinkung über QR-Codes, die nicht selten in TikTok-Videos oder Profilbildern eingebettet sind und mitunter direkt in relevante Telegram-Kanäle führen.
Diese Vorgehensweise erlaubt eine unauffällige Migration von Nutzerinnen und Nutzern aus offenen (einsehbaren), stark frequentierten Plattformen in geschlossene, schwierig zu überwachende Kommunikationsräume. Telegram und vergleichbare Messengerdienste fungieren damit als Knotenpunkte, die sowohl Anonymität als auch eine durchgängige Reichweite innerhalb eines abgeschlossenen Zirkels garantieren. Damit werden Social-Media-Plattformen wie TikTok bzw. Telegram zu Verstärkern für sogenannte stochastische Gewaltakte, die sich kurzfristig und taktisch in einer Low-Level-Manier, also in niederschwelligen Angriffsvarianten sowie komplementären Modi operandi (Messer- oder Kfz-Rammattacken) manifestieren.
Extremistische Manifestationen in Europa
Seit Ende 2023 häufen sich Fälle junger Einzeltäter der Generationen Z und – ja – auch Alpha, die – immer wieder auch inspiriert von aufgeladenen Gaza-Narrativen – Anschläge in Europa planten oder durchführten. Charakteristisch ist eine zunehmende Multidimensionalität bei den Motivlagen: seien es persönliche Kränkungen, soziale Isolation und Marginalisierung oder psychopathologische Ursachen. Bestehende Krisen-Rhetoriken und Opferdiskurse verschränken sich mit digital vermittelten, extremistischen Ideologiefragmenten. Diese Konstellationen führen zu schwer vorhersehbaren, häufig spontanen, gelegenheitsgetriebenen (= stochastischen) Gewaltausbrüchen, die wahlweise als „terroristisch“ oder als „amokartig“ klassifiziert werden können. Hiermit korrespondiert eine wachsende Zahl vereitelter Anschläge in Österreich und anderswo, bei denen extremistische TikTok-Inhalte als unmittelbare Radikalisierungsquelle identifiziert wurden.
Signifikanz des Konflikt-Terror-Nexus
Die Verknüpfung von Schockbildern, digitalen Narrativen und Gewalt aus Konfliktregionen wie Gaza im europäischen Informationsraum unterstreicht die steigende Relevanz des Konflikt-Terror-Nexus. Er erlaubt es, die immanenten Zusammenhänge zwischen internationalen Konfliktlagen und lokaler Gewalt sichtbar zu machen und zu instrumentalisieren. Gaza-Bilder wirken als „Mobilisierungstrigger“, die im europäischen Kontext in Online-Radikalisierungsprozesse übersetzt werden. Gleichzeitig zeigen aktuelle Fallkonstellationen wie etwa der Terrorakt von Villach vom vergangenen Februar, dass die Grenze zwischen geplanten terroristischen Aktionen und spontanen Gewaltausbrüchen zunehmend verwischt. Für Sicherheitsbehörden bedeutet dies: Prävention muss angesichts eines tobenden Propagandakriegs vermehrt digitale Resonanzräume sowie gleichermaßen offene bzw. geschlossene Kommunikations-Plattformen in den Blick nehmen, um eine gezielte virtuelle Überflutung mit antisemitischen Stereotypen und eigens konstruierten Opfer-Rache-Narrativen zu unterbinden.
So what?
Terrorismus wird in Europa immer stärker durch digitale Hybridität und eine Konnektivität zu globalen sicherheitspolitisch relevanten Lagen geprägt. Konflikte wie Gaza als Symbol, soziale Medienplattformen wie TikTok als Multiplikator und individuelle Krisenerfahrungen als Treiber formen einen gefährlichen Dreiklang, der die Entstehung stochastischer Gewalt in Form von niederschwelligem Terrorismus begünstigen kann und dies bereits tut. Der Konflikt-Terror-Nexus macht sichtbar, wie tief globale Auseinandersetzungen mittlerweile in die Lebenswelt europäischer, oftmals migrantischer Jugendlicher in der Diaspora hineinwirken und dort eine latent bestehende Gewaltbereitschaft als Reaktion auf Opfersemantiken stimulieren bzw. kanalisieren können. Daher setzt eine gelingende Präventionspolitik auch zugleich ein grundlegendes Verständnis von internationaler Sicherheitspolitik voraus.
NICOLAS STOCKHAMMER ist Politikwissenschaftler mit den Schwerpunkten Sicherheitspolitik und Terrorismusforschung. Von 2004 bis 2006 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Hochschullehrer am Lehrstuhl für Politische Theorie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bis 2021 war Stockhammer als Senior-Post-Doc-Forscher der Forschungsgruppe Polemologie und Rechtsethik an der Universität Wien tätig. Derzeit ist Nicolas Stockhammer mit der wissenschaftlichen Leitung und Koordination des Forschungsclusters „Counter-Terrorism, CVE (Countering Violent Extremism) and Intelligence“ im Department für Recht und Internationale Beziehungen an der Donau-Universität Krems betraut. Aktuelle Publikationen: „Routledge Handbook on Transnational Terrorism“, London: Routledge 2023 (als Herausgeber); „Lehrbuch Terrorismusbekämpfung und Extremismusprävention“, Wiesbaden: Springer VS 2023 (zus. mit Stefan Goertz) sowie „Trügerische Ruhe. Der Anschlag von Wien und die terroristische Bedrohung in Europa“, Wien: Amalthea Signum 2023.









