Österreich und die strategische Autonomie
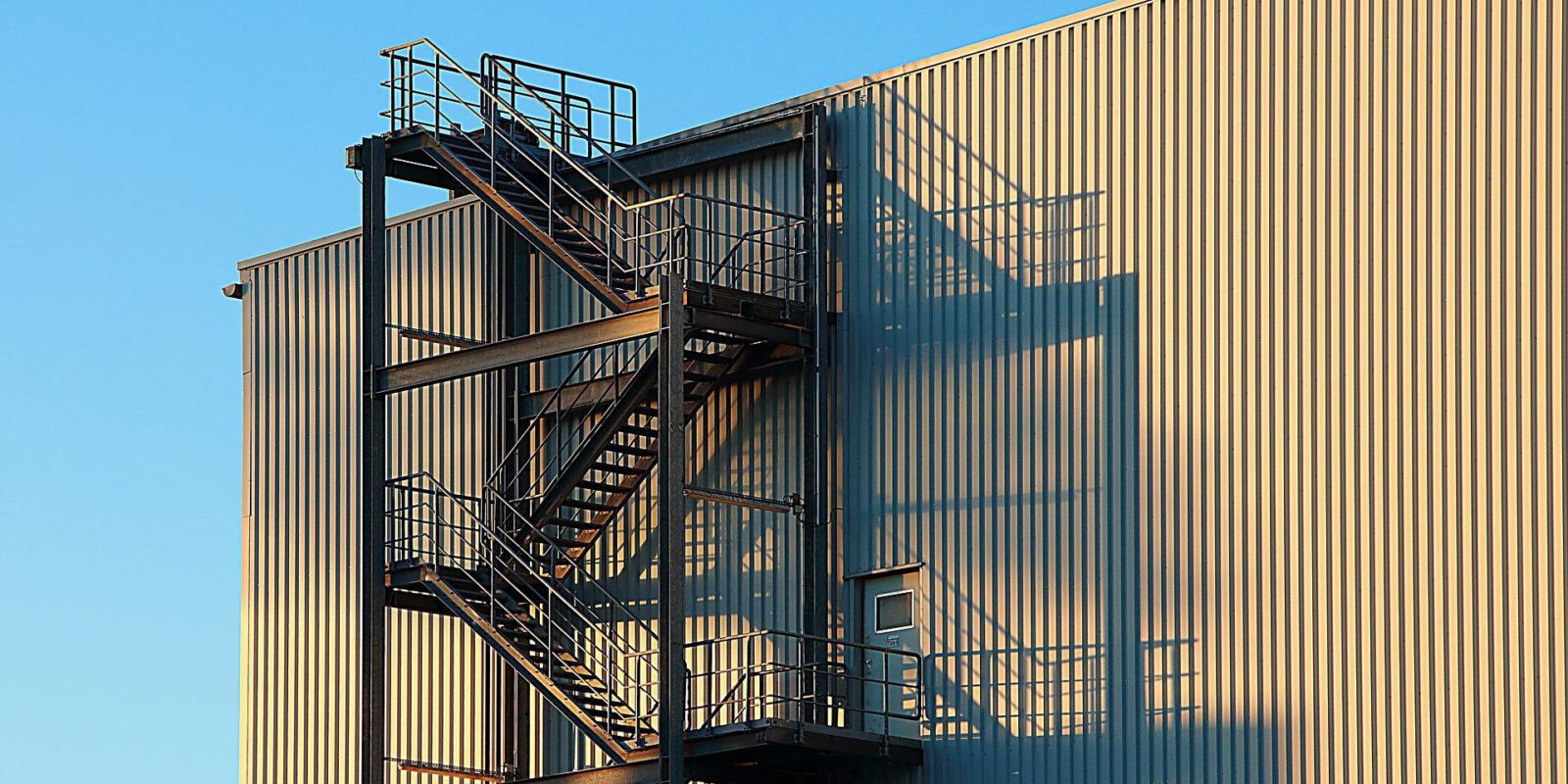
Ein Begriff aus der europäischen Sicherheitspolitik dominiert nun seit Jahren die europäische Handelsagenda: die „strategische Autonomie“.
Ausgangspunkt ist der schleichende Bedeutungsverlust des europäischen Wirtschaftsraums durch die zunehmende Globalisierung, Abwanderung der Produktion und der damit verbundene Aufstieg von Schwellenländern. Produktionsketten wurden immer verzweigter bzw. internationaler und erlaubten es Unternehmen, ihre Waren immer billiger herzustellen. Das bedeutete aber auch oft, dass Arbeitsplätze aus Europa in Niedriglohnländer wanderten.
Tendenzen, diesen Trend durch Protektionismus umzukehren, gab es also schon seit vielen Jahren. Die Covid-19-Pandemie hat einerseits die Fragilität von Lieferketten aufgezeigt und andererseits auch die Gefahren unterstrichen, die eine solche Abhängigkeit für den europäischen Binnenmarkt bedeutet. Der Wunsch europäischer Regierungen, sich von externen Faktoren unabhängiger zu machen, wurde weiter befeuert. In zahlreichen Treffen in Brüssel betonte man das Ziel, mehr „made in Europe“ sicherzustellen, gerade bei strategischen Industrien wie im Pharmabereich. Der russische Angriffskrieg hat die Folgen der Abhängigkeit Europas nochmals deutlich hervorgehoben und die europäischen Bemühungen nach Diversifizierung der Bezugsquellen verstärkt.
Ein Begriff, der viel bedeuten kann
Allein bei Rohstoffen zeigen Erhebungen der EU-Kommission ganz deutlich, dass die Union Partnerschaften mit verbündeten Staaten ausbauen muss, also nur auf Zusammenarbeit setzen kann. In der neuen Industriestrategie wurden 137 Produkte ermittelt, von denen die EU in hohem Maße abhängig ist, die aber gleichzeitig für den digitalen und ökologischen Wandel essenziell sind. Allein die Hälfte der Einfuhren für derartige Produkte stammen aus China. Eine stärkere Diversifizierung der Handelsbeziehungen ist somit das Gebot der Stunde und würde Europa letztlich stärken. Riskant sind Schlagworte wie „strategische Autonomie“ dort, wo durch Abschottung versucht wird, sich einen Vorteil zu verschaffen, ohne auf die langfristigen Folgen für den Wettbewerb, Lieferketten, Investitionen und Beziehungen zu Handelspartnern zu achten.
„Strategische Autonomie“ kann also viel bedeuten und birgt neben Chancen auch zahlreiche Risiken. Mehr Europa wünscht man sich bei der Digitalisierung, bei Rohstoffen, bei Investitionen usw. – also so ziemlich bei allem Möglichen. Es ist ein Schlagwort, eine Mischung aus einem legitimen Ziel nach mehr Resilienz durch Unabhängigkeit und einer Spur patriotischer Naivität.
„Strategische Autonomie“ auf Österreichisch
Die Position österreichischer Regierungsvertreter:innen war dabei stets klar: Die ehemalige Bundesministerin Margarete Schramböck war schon bei ihrem Jobantritt eine große Anhängerin protektionistischer Bewegungen. Ihre Begeisterung für mehr strategische Autonomie ist rückblickend wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass sie schon seit 2017 eine starke Stimme in Europa für eine politischere Fusionskontrolle war. Damit ist gemeint, dass Monopolbildung eher riskiert werden solle, wenn die Chance besteht, dass ein europäisches Unternehmen weltweit einen oder mehrere Wirtschaftsbereiche dominieren könne. Das damalige Modewort war „European Champions“.
Die negativen Effekte auf den europäischen Binnenmarkt oder mögliches Aussterben europäischer KMUs in ausgewählten Sektoren werden dabei ausgeklammert bzw. bewusst in Kauf genommen. Da hilft es auch nicht, dass sämtliche Expert:innen in diesem Bereich sowie die EU-Kommission vor den Folgen eines solchen Eingriffs warnten. Ob Schramböck beispielsweise die Entstehung eines portugiesisch-spanisches Monopolunternehmens auf Kosten ehemals erfolgreicher österreichischer KMUs auch gut gefunden hätte, wollte sie nie direkt beantworten.
Mehr „strategische Autonomie“ verfolgte sie ab 2020 damit, dass sie sich für scharfe Kontrollen ausländischer Investitionen einsetzte. Wie der erste Bericht der neu geschaffenen Behörde belegte, schoss die ehemalige Wirtschaftsministerin mit dem Investitionskontrollgesetz 2020 über das Ziel in der EU-Vorgabe hinaus. Während der pandemiebedingte Ausverkauf an China als Schreckgespenst an die Wand gemalt wurde, zeigte sich, dass die neuen Kontrollen fast ausschließlich gegen OECD-Partnerländer gerichtet waren. Ein offensichtlicher Fall, Geldwäsche durch Kauf einer Kärntner Regionalbank durch russische Investoren zu ermöglichen, wurde von der Investitionskontrollbehörde jedoch genehmigt und musste erst durch die Finanzmarktaufsicht gestoppt werden.
Im Pharmabereich verfolgte man einen klassisch österreichischen Ansatz und versuchte, mit Förderungen die Medikamentenproduktion in Österreich zu halten. Seit zwei Jahren liegt diese Beihilfe bei der EU-Kommission – das lässt nicht besonders viel Raum für Optimismus hinsichtlich einer Genehmigung zu. Tiefgreifende Reformen zur Attraktivierung des Standorts wären wohl ein vernünftiges Mittel, mehr Produktion nach Österreich zu locken bzw. hier zu halten. Zumindest Ähnliches wurde vage angekündigt: Die für Ende 2021 versprochene Standortstrategie sollte die Rahmenbedingungen in Österreich auf das Jahr 2040 ausrichten. Bekannt ist lediglich, dass die Erstellung bisher 300.000 Euro gekostet hat. Sonst sind selbst im Sommer 2022 keine Inhalte, geschweige denn konkrete Gesetzesvorhaben, bekannt.
Die Autonomie im Parlament
Eine erdrückende Mehrheit im österreichischen Nationalrat sieht Freihandel auch sehr skeptisch. Autonomie findet zwar jeder gut, nur soll man das Ziel gefälligst allein erreichen. Sitzungen des EU-Unterausschusses des Nationalrats haben gezeigt, dass internationaler Handel mehr als Bedrohung denn als Chance gesehen wird: Bereits in der vergangenen Legislaturperiode stimmten am 18. September 2019 vier von fünf Parteien für eine Blockade auf EU-Ebene des Freihandelsabkommens mit dem südamerikanischen Staatenbund MERCOSUR. Das war auch der Grund, warum die Wirtschaftsministerin unter der darauffolgenden Regierung Kurz II immer wieder betonte, dass ihr die Hände durch diese Entscheidung gebunden seien.
Diese Positionierung war zum einen deshalb fragwürdig, da die Abgeordneten nicht für immer daran gebunden sind – ein neuer Beschluss der Regierungsparteien hätte gereicht. Andererseits kann allgemein die Sinnhaftigkeit einer kompletten Blockade der Vertiefung von Handelsbeziehungen zu Südamerika hinterfragt werden. Unabhängig davon, wie man den Inhalt des Abkommens z.B. in Umweltfragen bewertet, sollten im Sinne eines konstruktiven Zugangs stets Verbesserungen angestrebt werden. Gerade angesichts der aktuellen Notwendigkeit der Intensivierung von Handelsbeziehungen mit demokratischen Staaten darf man die Frage stellen: Wie sinnvoll ist es, nicht einmal Gespräche zuzulassen?
Bemerkenswert ist, dass in der zweiten Kammer des österreichischen Parlaments die Abgeordneten der Regierungsparteien am 10. März 2020 einen Antrag von SPÖ und FPÖ zur Blockade von MERCOSUR mit Hinweis auf die Notwendigkeit von Gesprächsbereitschaft ablehnten. Der Nationalrat blieb skeptisch gegenüber dem Freihandel, wie eine Sitzung des EU-Ausschusses am 20. April 2022 zeigte: Ein Antrag für ein allgemeines Bekenntnis zu wertebasiertem Freihandel mit Partnerländern sowie die Anregung einer Analyse neuer strategischer Partnerschaften auf EU-Ebene wurde wieder von vier von fünf Parteien abgelehnt. Die negative Haltung wird neben der erwähnten Abstimmung 2019 offen damit begründet, dass Freihandelsabkommen unbeliebt sind. Dies erscheint angesichts der aktuellen Situation, der globalen Ressourcenverteilung oder der Positionierung im internationalen Wettbewerb nicht vernünftig.
Als ehemaligem Wirtschaftsforscher ist dem jetzigen Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, der am 1. Mai 2022 die Wirtschaftsagenden übernommen hat, der Wert globaler Wirtschaftsketten selbstverständlich bekannt. Dieser hielt bei seinem ersten EU-Wettbewerbsrat am 22. Juni fest, dass es wichtig sei, „nie von vollständiger Unabhängigkeit zu sprechen“. Dabei betonte er die großen Vorteile des internationalen Handels. Andererseits hat der neue Wirtschaftsminister einen Brief von 15 EU-Kollegen nicht unterschrieben, in dem die EU-Kommission aufgefordert wird, Verhandlungen mit Partnern rasch zu vertiefen.
Die kommenden Monate werden somit zeigen, ob Bundesminister Kocher sich auf EU-Ebene gegen protektionistische Tendenzen stemmen wird. Spannend wird auch sein, wie sich die parlamentarische Mehrheit im Nationalrat hinsichtlich eines konstruktiveren Kurses in der österreichischen Handelspolitik entscheiden wird.









