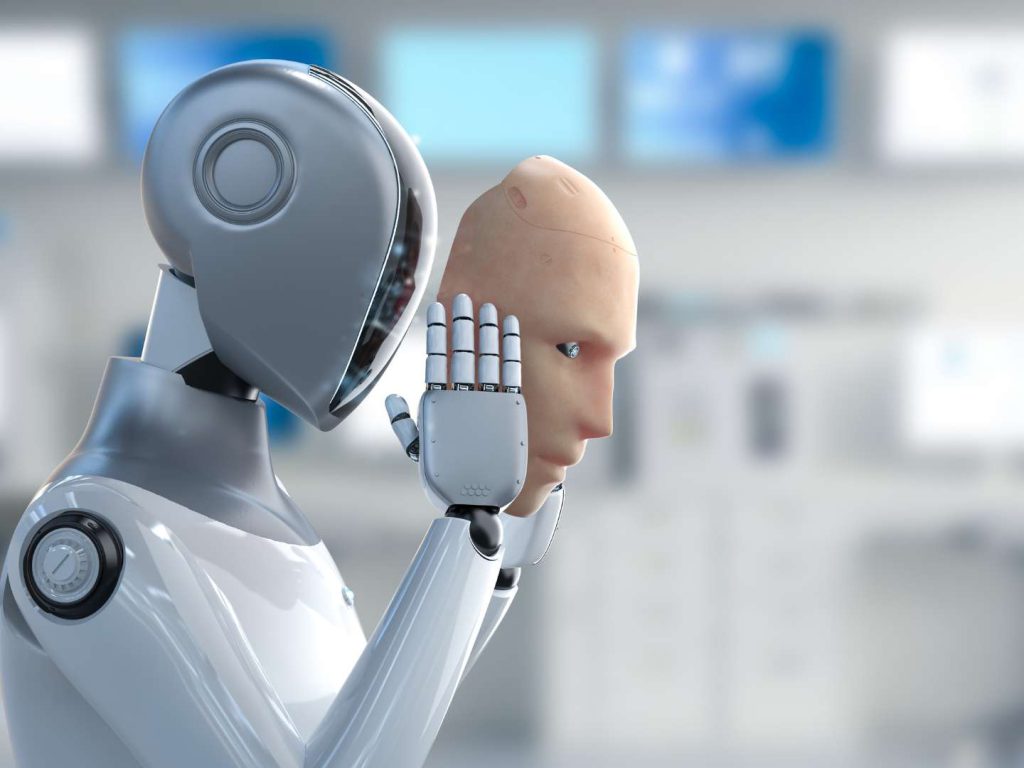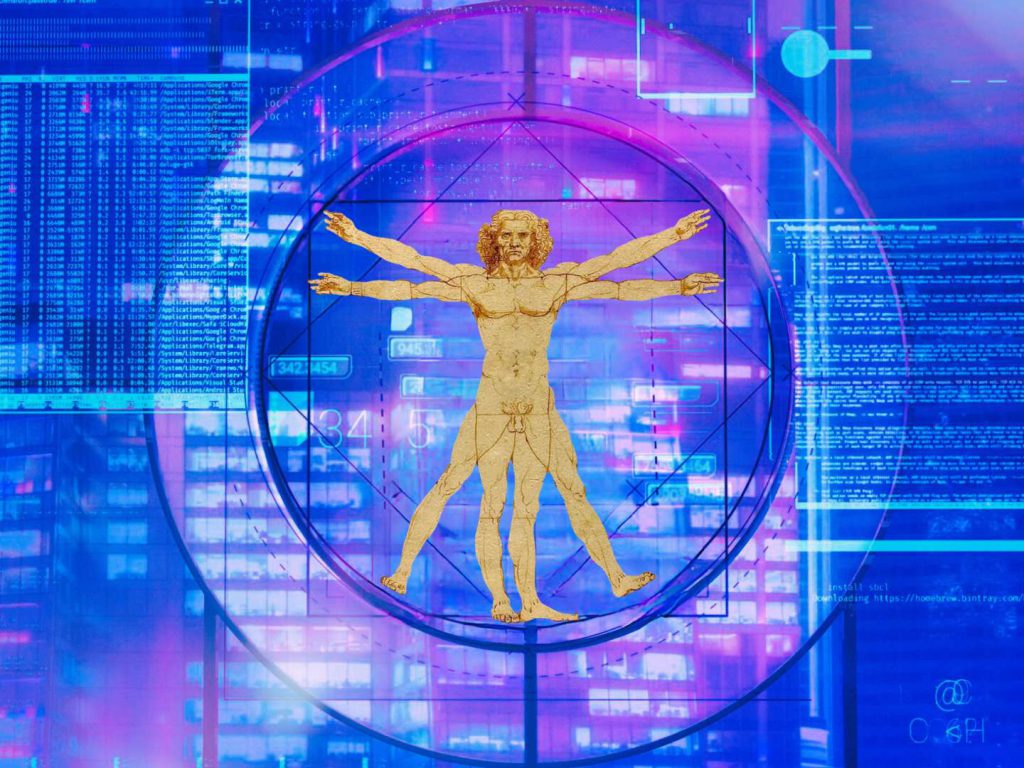Mental Health gehört in die Schulen

Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir – heißt es. Was wir in der Schule aber noch viel zu selten lernen, ist, wie wichtig Gesundheit ist und welchen großen Anteil davon psychische Gesundheit einnimmt. Um das zu ändern, müssten die Zuständigkeiten geklärt sein.
Psychische Gesundheit ist nicht nur eine Frage der Psyche. Viele Angst- oder Belastungsstörungen entstehen durch frühe Prägungen, für Verhaltensstörungen und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit gibt es einen eigenen Diagnosecode. Denn gerade in der Kindheit und Jugend lernen wir sehr viel über und mit anderen Menschen. Emotionale Beziehungen und Sozialverhalten haben also eine Schlüsselrolle für die Entwicklung unserer Psyche.
Genau an dieser Kreuzung von Sozialem und Gesundheit scheitert „das System“ aber oft auch heute noch. Denn Sozialarbeit wird nicht unbedingt als ein Beitrag zu Förderung, Erhalt oder Wiederherstellung von Gesundheit gesehen. Stattdessen wurde jahrzehntelang von Psychiater:innen (oder Medikation zur Beruhigung) als Lösung gesprochen, mit der Zeit hat sich ein Fokus auf Psycholog:innen verschoben – obwohl diese in Österreich nicht behandeln, sondern meistens „nur“ diagnostizieren dürfen, das machen meistens Psychotherapeut:innen. Nachdem diese Verteilung schon im Gesundheitssystem für viel Verwirrung sorgt, kann man sich vorstellen, wie die Aufgabenteilung in der Schule abläuft.
Denn seit der beziehungsweise durch die Pandemie ist eben gerade die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ein größeres Thema als früher. Grundsätzlich zeichnet sich schon seit rund 15 Jahren ein größeres Bewusstsein für beispielsweise Mobbing ab, durch die Pandemie wird jetzt aber auch aktiv Fürsorge eingefordert, wie über das Jugendvolksbegehren. Gut, aber das System war (wie das Gesundheitssystem) schon vor Covid überlastet. 2018 ging sich in Wien ein:e Schulsozialarbeiter:in für über 12.000 Kinder aus, bei den Schulpsycholog:innen sah die Lage ähnlich aus.
Alle und keiner sind zuständig
Neben dem grundlegenden Personalmangel in Sozial- und Gesundheitsbereich gibt es in den Schulen nämlich auch die Finanzierungsproblematik. Je nach Schulform teilen sich Bildungsministerium und das jeweilige Bundesland die Finanzierung, in Gymnasien ist nur der Bund zuständig. Teilweise kann es in Bundesländern vorkommen, dass Vereine in Schulen tätig sind, die sonst über die Jugendarbeit und damit die Sozialbudgets der Bundesländer finanziert werden. Durch die vermehrten Hilferufe in der Pandemie hat das Gesundheitsministerium mit „Gesund aus der Krise“ jetzt außerdem ein zusätzliches Projekt, über das es ebenso Behandlungen in Schulen anbieten kann.
Positiv ist also, dass viele Stellen involviert sind und sich um eine Verbesserung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen bemühen. Negativ ist, dass dadurch immer auf andere verwiesen wird, Finanzierung und Stellenpläne bestenfalls unübersichtlich sind und dass potenziell immer jemand anderes und nie die Stelle zuständig ist, mit der man redet.
Gerade die geteilte Finanzierung zwischen Bund und Ländern sorgt in diesem Kontext für ein Problem. Lange hat es geheißen, dass das Bildungsministerium nicht so weit ausbauen wollte wie die Länder. Durch einen Fehler musste das Unterstützungspersonal an Bundesschulen zwischenzeitlich gestrichen werden. In Vorarlberg beispielsweise war das Thema das ganze Jahr hindurch ein Dauerbrenner, kurz vor Ferienbeginn wurde ein Antrag der Landesregierung an sich selbst angenommen, dass vier Personen dafür wieder angestellt werden sollen. Die Wirkung wird in erster Instanz minimal sein, diese Personen sind vom Bildungsministerium schon zugesichert. Die Handlungsbereitschaft der Landesregierung ist mau, die Verfügbarkeit von Personal beschränkt. Aber der Beschluss symbolisiert zumindest Bewegung in der Frage.
Resilienz und Thematisierung in der Schule
Die große Frage bei diesem Hin und Her ist aber immer: Was braucht es wirklich? Wer wie an Bundes- oder Landesschulen dafür anwesend ist, ist in vielen Bereichen nicht unbedingt die entscheidende Frage. Oft geht es in erster Instanz darum, dass Kinder und Jugendliche in Problemsituationen eine Ansprechperson haben, die zur Verfügung steht. Ob das ein:e Vertrauenslehrer:in, ein:e Psycholog:in, Sozialarbeiter:in oder Psychotherapeut:in ist, ist im ersten Moment gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Kinder erkennen können, wenn es ihnen nicht gut geht, und dass es gesellschaftlich normalisiert wird zu sagen: „Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.“
Je nachdem, ob es sich um Mobbing, um Leistungsdruck, die Scheidung der Eltern oder eine zu diagnostizierende Lernschwäche, Essstörung oder was auch immer handelt, muss sich die weitere Vorgehensweise ja anpassen und dementsprechend auch die Person, die Unterstützung liefern soll. Ein ganz gut funktionierendes System ist deshalb „Gesund aus der Krise“, das unter Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein gestartet wurde und je nach Bedarf an Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen verweist. Blöderweise ist es ein System, das einen vorhandenen Mangel im Gesundheitssystem ausgleicht und kein spezifisches für die Schule – niederschwellig und vor allem in Schulen dafür Werbung zu machen, scheint aber gute Ergebnisse zu bringen.
Mitberücksichtigt werden sollte aber, dass Sozialarbeiter:innen, Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen in der Schule keine Dauerbehandlung anbieten sollen, sondern nur in der ersten Situation, wenn Lehrer:innen Probleme bemerken, unterstützen und klären sollen. Geht es beispielsweise um Mobbing, können Sozialarbeit und eine Aufstellung der Klasse helfen, andererseits kann es auch hilfreich sein, wenn betroffene Kinder in eigenen Stunden herausfinden können, warum sie mobben oder wie sie ihre Resilienz gegen derartige Situationen stärken können.
Hilfe zur Selbsthilfe
Wichtig ist deshalb, nicht nur über eigenes (zusätzliches) Personal zu reden, sondern eben die Mechanismen hinter psychischer Gesundheit in Schulen unterzubringen. Wenn Kinder und Jugendliche schon verstehen, welche Typen es gibt, welche persönlichen Probleme soziale Probleme in der Schule triggern können und woran man das erkennt – und damit potenzielle Täter auch gleich auf diese Dynamiken aufmerksam macht –, könnten Kinder und Jugendliche gleich viel mehr Werkzeuge auch für ihre psychische Gesundheit über den gesamten Lebensverlauf in der Schule bekommen.
Mit „Gesund aus der Krise“ und einer Hotline, über die zehn Stunden Therapie genutzt werden können, wird sich das aber nicht richten lassen. Viel eher braucht es eben ein gesamtes Umdenken von Schule. Was muss gelernt werden, und was brauchen Menschen, um gesund durch das Leben zu kommen? Gemessen an rund 14.000 Frühpensionierungen in den fünf Jahren bis Dezember 2021 könnte mehr Engagement im Bereich psychische Gesundheit eine ganz gute Idee sein.
Zusätzlich spielen weitere Gesundheitsfaktoren in diese Überlegungen hinein. In Island wurde auf ein derartiges System umgestellt. Kinder und Jugendliche werden aktiv zu Sport und Vereinsaktivitäten motiviert, bekommen erklärt, wie Bewegung oder Musik sich auf die Psyche auswirken, und das schon vom Kindergarten an.
Dort ist das Konzept aufgegangen: In Island sind Jugendliche kaum noch an Suchtmitteln interessiert – Alkohol-, Nikotin- und Drogenkonsum sind enorm zurückgegangen. Und das, obwohl der Umgang mit Cannabis in kleinen Mengen weniger streng gehandhabt wird als in Österreich. Was in Island aber jedes Kind schon weiß, ist, dass Alkohol nur betäubt und die zugrundeliegenden Probleme nicht löst. In Österreich stattdessen gibt es ja oft genug noch den Galgenhumor, dass ein Feierabendbier den miesen Tag schon wieder ausgleichen wird.
Langer Weg im Kompetenzdschungel
Wer eben schon in der Schule lernt, wann es sich (nicht) auszahlt, etwas persönlich zu nehmen, wie man lernt, „Nein“ zu sagen oder ein klärendes Gespräch sucht, wird aller Hoffnung nach nicht die gleichen Probleme bekommen. So wie es aussieht, braucht es bis zu diesem Punkt aber noch einige klärende Gespräche zwischen den involvierten Stellen.
Bildungsministerium und Gesundheitsministerium arbeiten angeblich kontinuierlich am Reformprojekt Schulgesundheit weiter, und auch im Rahmen des Finanzausgleichs soll psychische Gesundheit stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Wie genau das Zusammenspiel mit und zwischen den Bundesländern zur gemeinsamen (und nicht nur geteilten) Finanzierung aussehen soll oder könnte, ist noch gänzlich unklar. Auch hier heißt es deshalb wohl: Warten auf den Finanzausgleich. Auch wenn viele Expert:innen von dieser Aussicht nicht unbedingt überzeugt sind.