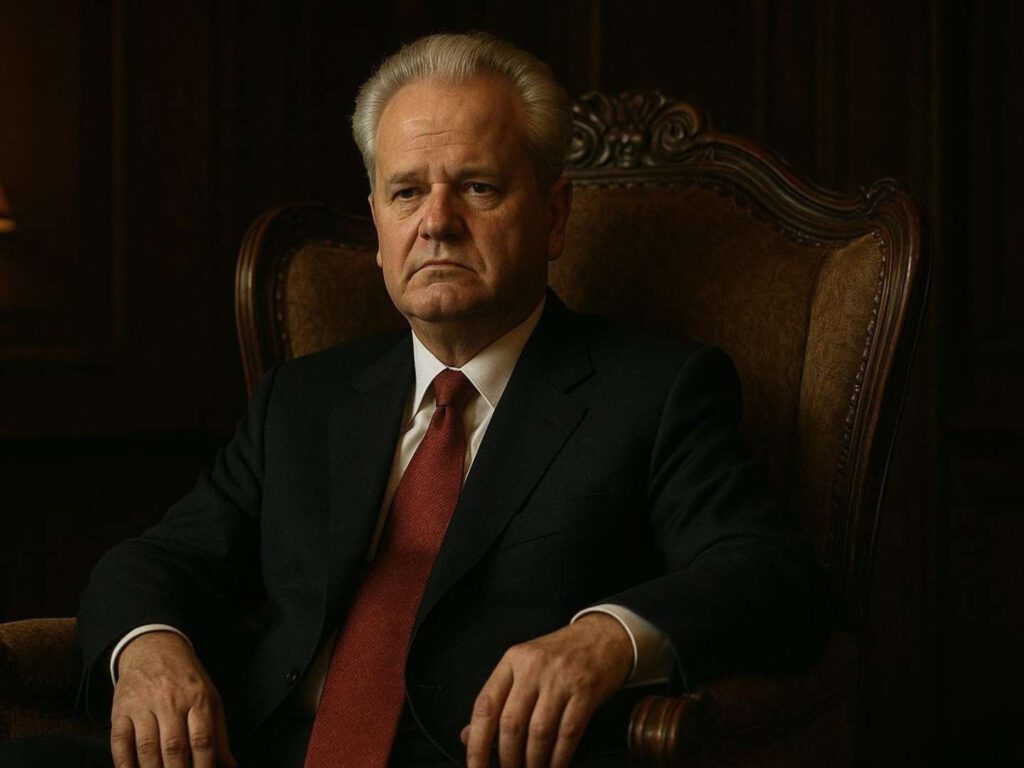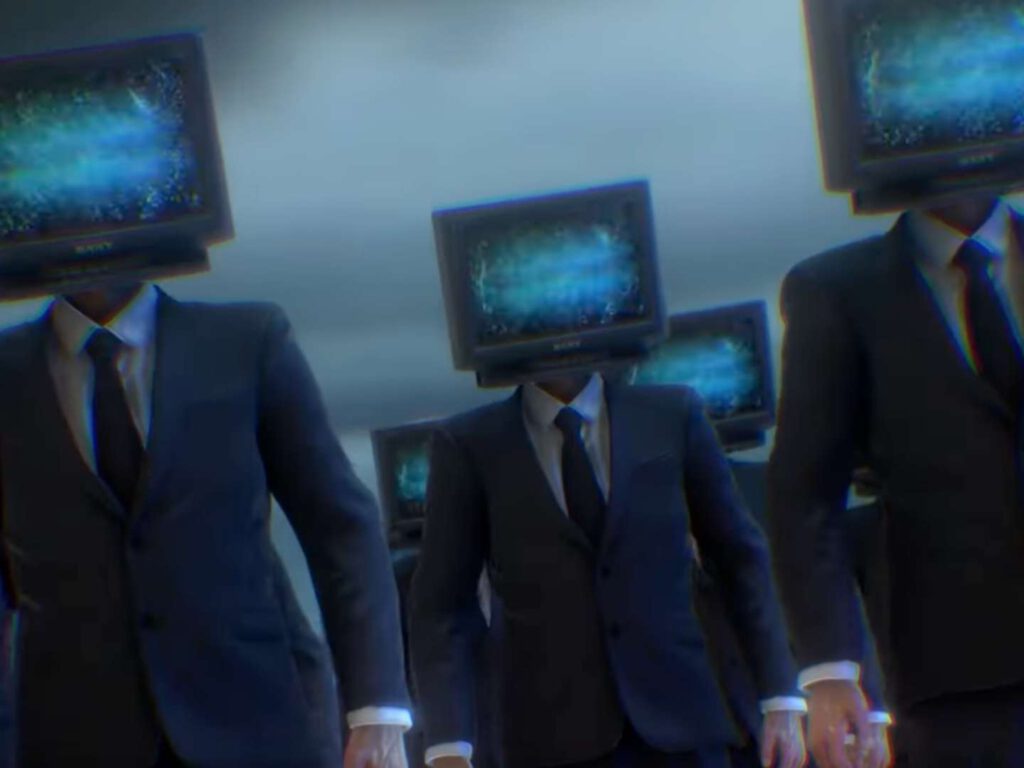Patientensteuerung: Wohin jetzt?

Lange Wartezeiten, volle Ambulanzen und Patient:innen am falschen Ort – viele Probleme im österreichischen Gesundheitssystem sind seit Jahren bekannt. Warum einfache Schuldzuweisungen an die Patient:innen zu kurz greifen, welche Steuerungsansätze es gibt und wo deren Grenzen liegen.
Wenn man Berichte über das Gesundheitssystem liest, fühlt man sich wie im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Immer wieder werden dieselben Probleme beschrieben: zu lange Wartezeiten, Patient:innen an der falschen Stelle, Ärzt:innen, die „Drehtürmedizin“ betreiben und sich über mangelnde Zeit für Patienteninteraktion beschweren.
Was Krankenhausambulanzen betrifft, kommt es sehr häufig zu der Kritik, dass Patient:innen nicht die vollen Ressourcen von Krankenhäusern benötigen. Je nach Krankenhaus können so zwischen 30 Prozent und bis zu zwei Drittel der Patient:innenkontakte folgendermaßen eingestuft werden: nicht dringlich und ohne Probleme auch im niedergelassenen Bereich behandelbar. Wenn man als Patient:in allerdings nicht weiß, wo die nächste Praxis ist und welche Versorgung man nun genau braucht, entscheiden sich viele interessanterweise nicht zuerst für die Allgemeinmedizinerin. Denn man hört hier immer wieder von Aufnahmestopps für neue Patient:innen und dass nur Notfälle behandelt werden können. Das ergibt zwar Sinn, kann aber Vorbehalte, wegen „Kleinigkeiten“ zu einem übervollen Arzt zu gehen, verstärken. Im Endeffekt entscheiden sich viele Patient:innen, teils aus guten Gründen, teils aus Unwissenheit, für die Ambulanz im Krankenhaus, weil diese ja ohnehin da ist.
Böse Zungen geben schnell den Patient:innen allein Schuld – Stichwort mangelnde Gesundheitskompetenz. Doch ganz so einfach darf man es sich nicht machen. Immerhin sucht man sich nicht aus, wie und welches Gesundheitswissen in Familie oder Schule vermittelt wurde. Und wer weiß schon, ob man bei Atemproblemen lieber zur Lungenfachärztin oder zum HNO-Arzt gehen sollte? Darum wird in der öffentlichen Debatte immer wieder die Steuerung über Hausärzt:innen angedacht – diese können solche Fragen beantworten. Dazu kommt auch, dass ein Besuch dort billiger ist als ein Facharztbesuch.
Häusärzt:innen als Vertrauenspersonen
Solche Lösungen mit sogenannten Vertrauensärzt:innen gibt es beispielsweise in den Niederlanden oder in Frankreich. Zwar ist die Ausgestaltung unterschiedlich, aber im Kern geht es immer darum, dass jede Person eine fixe Anlaufstelle für die allgemeinmedizinische Versorgung hat. Erst wenn die Vertrauensärzt:in sagt, dass andere Fachkompetenzen nötig sind, erfolgt eine Weiterleitung. Grundsätzlich ist das mit den Überweisungen in Österreich vergleichbar, allerdings wird hier weniger gesteuert. So kann beispielsweise für ein Röntgen oder eine Blutuntersuchung eine Überweisung ausgestellt werden, wann und wo genau diese dann erfolgen, müssen die Patient:innen jedoch selbst aussuchen. Und da wird wieder die systemische Gesundheitskompetenz relevant. So wissen, um beim Beispiel des Röntgen zu bleiben, viele Menschen nicht, dass es für bildgebende Untersuchungen ein Übersichtsportal gibt, auf dem alle Institute mit den jeweiligen Wartezeiten vermerkt sind. Wer stattdessen wahllos herumtelefoniert, um dann in einem Wahlinstitut zu landen, hat schnell ein Problem mit den höheren Kosten, welche auch die Kasse nicht unbedingt gerne trägt.
Doctor Calling
Eine Alternative zu Hausärzt:innen, die als Vertrauenspersonen durch das System leiten, ist die verstärkte Patient:innensteuerung über die Gesundheitshotline 1450. Auch dieses Konzept gibt es in anderen Ländern, in Deutschland beispielsweise über die Kassenärztliche Bundesvereinigung. In Österreich hat 1450 aber noch immer das Problem, in erster Linie als Covid-Hotline wahrgenommen zu werden, außerdem gibt es noch keine Anbindung an den niedergelassenen Bereich und damit eben an Arztpraxen. Im besten Fall wird Patient:innen also bei 1450 erklärt, wohin man denn theoretisch sollte. Wie man anschließend dorthin kommt, ist noch nicht Teil der Maßnahme. Es gibt bereits weitreichende Pläne: von einem Telemedizin-Portal über eine Terminbuchungshotline bis zur ELGA-Anbindung des Telefonservices. Wichtig dafür ist die Bereitschaft der Bundesländer, ihre Angebote zu 1450 zu vereinheitlichen – und da sehen diverse Rechnungshöfe, beispielsweise in Oberösterreich und Kärnten, noch einiges an Potenzial.
Geld regiert die Welt
Weitaus direktere Auswirkungen auf die Bevölkerung hat eine Steuerung durch die Finanzen. So haben beispielsweise die SVS und die BVAEB Selbstbehalte. Die Versicherten dieser Kassen müssen bei einem Arztbesuch also einen gewissen Eigenbeitrag zahlen. Dadurch soll mehr Bewusstsein dafür geschaffen werden, was Gesundheitsleistungen kosten und welche man in Anspruch nimmt. Die SVS bietet dafür an, dass bei der Nutzung von Vorsorgeuntersuchungen und aktiver Gesundheitsprävention der Selbstbehalt reduziert wird – gesundes Verhalten wird also belohnt. Analog dazu gab es früher in Krankenhäusern eine sogenannte Ambulanzgebühr. Deren Lenkungseffekte waren zwar schon damals umstritten, dennoch ist die Diskussion darüber wieder entbrannt. Die ÖGK wiederum hat als „Sparmaßnahme“ eine Gebühr für Krankentransporte eingeführt und will mit Ausnahmen die Lenkungseffekte so steuern, dass es zu keinen Benachteiligungen bei Patient:innen kommt.
Auch bei der finanziellen Steuerung gibt es entlang der Patientenpfade diverse Modelle. Je nach Ausgestaltung verspricht man sich davon mehr „richtige Versorgungspfade“ im System, mehr Gesundheitsbewusstsein bei Patient:innen und weniger Besuche bei der falschen medizinischen Einrichtung. Dafür braucht es im Idealfall aber auch ein Zusammenspiel der Gesundheitseinrichtungen – Stichwort Digitalisierung – und eine klare Kommunikation mit der Bevölkerung. Wenn Ärzt:innen vorausgehende Befunde nicht haben oder nicht sehen, welche Arztkontakte es schon gab, ist schließlich nur schwer nachvollziehbar, ob ein:e Patient:in sich an einen vorgegebenen Patientenpfad gehalten hat oder nicht. Auch die Patientensteuerung ist deshalb ein Thema, das im Finanzausgleich behandelt wurde. Fraglich ist, ob die Lösungsansätze aus dem letzten Finanzausgleich ausreichend umgesetzt werden. Nachdem die Protokolle aus dem zuständigen Gremium aber immer erst mit einiger Verzögerung veröffentlicht werden, weiß man das derzeit noch nicht.