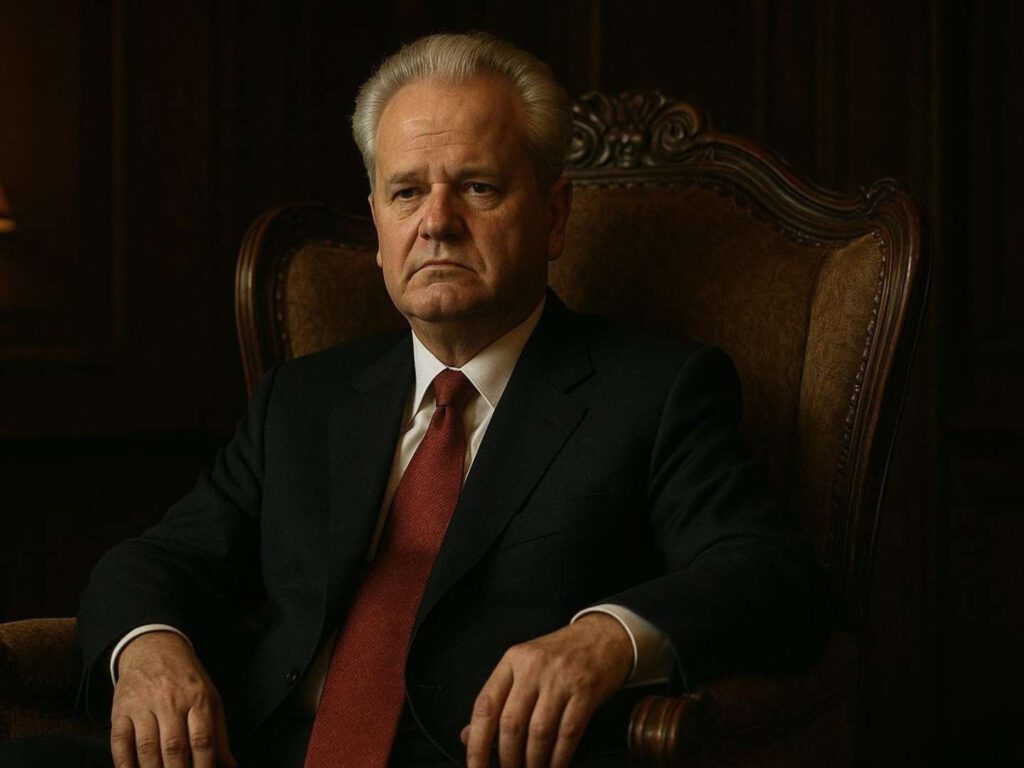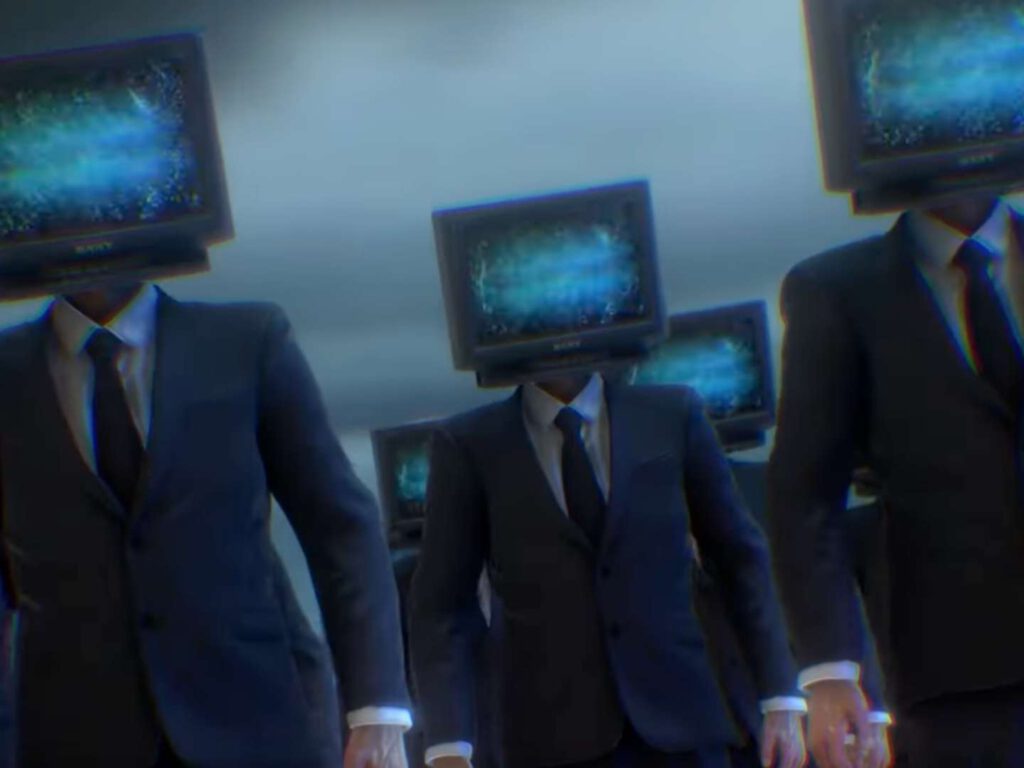Zaubermittel Gesundheitskompetenz – aber wie geht das?

Unser Gesundheitssystem ist stark belastet. Das zeigt sich einerseits an längeren Wartezeiten für Patient:innen, gleichzeitig merken das aber auch die Beschäftigten im Gesundheitswesen an der steigenden Zahl an Patient:innenkontakten. Einfach gesagt: Mehr Menschen gehen öfter zu Ärzt:innen. Eine Erklärung dafür ist die eher mäßige Gesundheitskompetenz der Bevölkerung. Wie kann diese gesteigert werden?
Gesundheitskompetenz ist „das persönliche Wissen und die persönlichen Kompetenzen, die durch alltägliche Aktivitäten, soziale Interaktionen und über Generationen hinweg aufgebaut werden. Diese Kenntnisse und Kompetenzen ermöglichen es den Menschen im Zusammenspiel mit organisatorischen Strukturen und der Verfügbarkeit von Ressourcen, sich so Zugang zu Informationen und Dienstleistungen zu verschaffen, diese zu verstehen, zu bewerten und anzuwenden, dass sie ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden für sich selbst und ihnen nahestehende Personen fördern und erhalten können“. Vereinfacht gesagt heißt das, Gesundheitskompetenz ist die Fähigkeit zu wissen, wann welche Maßnahme zur Verbesserung des Gesundheitszustands angebracht ist und wo diese erfolgt. Gesundheitskompetenz ist also nicht nur Wissen über Gesundheit, sondern auch über das Gesundheitssystem – und das ist ein Problem.
Denn das österreichische Gesundheitssystem gehört nicht unbedingt zu den einfachsten seiner Art. Abseits der Finanzierungsproblematik stellt sich Patient:innen immer die Frage: Was ist der richtige Zeitpunkt, um ins Krankenhaus zu gehen, wann brauche ich eine Fachärztin oder „nur“ einen Allgemeinmediziner, und gehe ich dafür lieber in eine Praxis oder in ein Primärversorgungszentrum?
Ein Drittel der Bevölkerung fühlt sich davon oft herausgefordert. So reicht für einen Ausschlag im Regelfall eine allgemeinmedizinische Betreuung, und trotzdem gibt es in Krankenhäusern voll mit Fachpersonal bestückte Terminambulanzen. Wer keinen Stammarzt hat, geht natürlich dort hin. Eine Ansatzmöglichkeit zur Lösung dieses Problems wäre die sogenannte Patientensteuerung, zu der auch gerade nach Lösungswegen gesucht wird. Also braucht es mehr Kompetenz bei den Patient:innen. Doch dafür müsste das System leichter nachvollziehbar sein. Daher ist es wohl einfacher, bei der Gesundheitskompetenz anzusetzen.
Wann bin ich überhaupt krank?
Spricht man mit Mitarbeiter:innen von Ärztefunkdienst, Rettung oder Krankenhausambulanzen, kommt schnell das Gefühl auf, dass die vielen ärztlichen Konsultationen auch nötig sind, weil die Menschen ihren Gesundheitszustand nicht zur Genüge selbst einschätzen können. Viele Patient:innen erfragen, ab wann eine erhöhte Körpertemperatur Fieber ist und Medikation braucht, oder welche Maßnahmen bei Durchfall helfen. Beispiele, die wie Lappalien klingen. Wenn aber um zwei Uhr in der Nacht diensthabendes Personal auf der Notfallambulanz aufgeweckt wird, weil jemand wissen will, ob der Durchfall vor zwei Wochen jetzt noch Auswirkungen auf die Gesundheit hat, wird die Unzufriedenheit des Krankenpersonals mit manchen Aspekten ihrer Arbeit nachvollziehbar. Anstatt nur darüber zu diskutieren, wie man solche Patient:innen wegschicken kann, braucht es auch ernsthafte Lösungsansätze.
Denn reine Zugangsbeschränkungen zum Gesundheitswesen werden nicht helfen. Sie können zwar zur Entlastung des Gesundheitssystems beitragen, dies aber nur um den Preis, dass die Bevölkerung sich im Stich gelassen fühlt. Es braucht also einen Weg, wie man „der breiten Masse“ beibringen kann, wann welche körperlichen Vorgänge medizinischen Beistand benötigen. Hier gibt es offensichtlich große Lücken, die, wenn aufgrund von Fehleinschätzungen voreilig um Hilfe gebeten, Fieber nicht selbst erkannt, oder bei Infektionskrankheiten die Ansteckung von Kolleg:innen riskiert wird, sowohl zu einer Über- als auch einer Unterversorgung führen.
Wissen ist Macht
Wer einfache Erklärungen mag, kann nun behaupten: Die Leute denken nicht mehr selbst mit. Ganz so einfach ist es aber nicht. Es ist ja nicht so, dass beispielsweise „Essigpatscherl“ als Behandlung vergessen wurden, sondern es fehlt oftmals die Erkenntnis davor. Wer nicht weiß, dass Fieber erst ab 38 Grad Körpertemperatur wirklich als Fieber zählt, macht sich natürlich leichter Sorgen und denkt erst gar nicht daran, dass man das selbst behandeln könnte. Wer dies nicht weiß, denkt ebenso schnell einmal: „Ach, ich fühle mich wieder gut und kann arbeiten gehen.“ Das mag zwar löbliches Pflichtgefühl sein, kann aber überflüssige Ansteckungsgefahr für andere Menschen bedeuten. Ähnlich verhält es sich bei der Frage, wann Schnupfen oder Husten einfach nur eine Erkältung sind und ab wann man von handelsüblichen Hustenzuckerln auf Lutschtabletten aus der Apotheke wechseln sollte.
Besonders problematisch ist, dass chronisch kranke Menschen sich im Gesundheitssystem schlechter auskennen als die Durchschnittsbevölkerung. Eine Erklärung dafür ist, dass viele Menschen mit chronischen Krankheiten durch das Gesundheitssystem tingeln und an jeder Stelle eine andere Information erhalten – was daran liegt, dass sich keiner richtig zuständig fühlt. Ein Beispiel dafür ist Diabetes: Theoretisch sollten Allgemeinmediziner:innen hier die Versorgung übernehmen, allerdings nimmt nur ein Bruchteil von ihnen am Versorgungsprogramm „Therapie aktiv“ teil. Viele Patient:innen bekommen ihre Kontrollen deshalb im Krankenhaus, was wiederum oft mit Wartezeiten und weiteren Wegen als in die nächste Arztpraxis verbunden ist. Hieran leidet wiederum die Regelmäßigkeit. Kontrollen werden öfter geschwänzt, Patient:innen wechseln zwischen Allgemeinmedizinerin, Krankenhaus und Facharzt, am Ende steht ein schlechter Krankheitsverlauf.
Das System hilft, das System verwirrt
Die übliche Empfehlung besagt daher, systematisch im Bildungssystem, also bei den Kindern, anzusetzen. Das Ziel: Mehr Gesundheitskompetenz im Rahmen des Schulunterrichts, mehr Bewegung in der Schulzeit und gesündere Essensangebote. Darüber hinaus kann beispielsweise im Biologieunterricht genauer erklärt werden, was Fieber eigentlich für den Körper bedeutet oder der Sachkundeunterricht Erklärungen zu saisonalem Gemüse und dessen Nährstoffwerten liefern. Ganz nebenbei wissen wir von Programmen wie easykids, das nun in immer mehr Bundesländern ausgerollt wird, dass Programme zur Steigerung der Gesundheitskompetenz von Kindern auch einen positiven Effekt auf die Gesundheitskompetenz von Eltern haben.
Insbesondere zur Erreichung Letzterer gibt es aber nur wenige Ideen, wie Bildungsprogramme bei Erwachsenen funktionieren könnten. Oft beinhalten Lösungsansätze das „Bereitstellen von Informationen“ – aber wie viele Menschen schauen wirklich auf gesundheit.gv.at, um herauszufinden, welcher Kopfschmerz ein Schmerzmittel benötigt und welcher vielleicht auf Verspannungen zurückzuführen ist? Erschwerend kommt hinzu, dass viele Bundesländer und Sozialpartner eigene Portale haben und es nach wie vor viel Überzeugungsarbeit braucht, um beispielsweise 1450 als Beratungshotline stärker zu etablieren – wiewohl an diesem Punkt hinzugefügt werden muss, dass jedes Bundesland eine eigene Website für 1450 gebaut hat, wo ebenfalls Informationen zu finden sind. Hier wurden zwar Angebote zur Steigerung der Gesundheitskompetenz zur Verfügung gestellt, anhand derer Österreicher:innen sich einfacher im Gesundheitssystem orientieren können, das aber um den Preis des Föderalismus – also eine Struktur mit neun verschiedenen Websites für neun verschiedene Angebote in neun verschiedenen Bundesländern. Dass es eine eigene Plattform Gesundheitskompetenz gibt, die sich ausschließlich um die Steigerung der Gesundheitskompetenz kümmert und Informationen vermitteln will, weiß hingegen kaum jemand.
Schon ironisch. Ein Drittel der Menschen findet sich im System nur schlecht zurecht, und als Abhilfe werden diese Menschen von vielen Seiten mit Informationen beschossen. Welche dieser Informationen wie gut sind oder wie diese Internetseiten überhaupt gefunden werden, ist aber nicht bei allen Maßnahmen zur Steigerung der Gesundheitskompetenz klar. Für zwanzig verschiedene – staatliche – Infoseiten Kampagnen zu machen, klingt schließlich auch kaum nach effizienter Mittelverwendung. Angesichts dessen scheint eine Bündelung der Ressourcen sinnvoll: eine Gesundheitshotline mit einer Website, ein öffentliches Gesundheitsportal mit Informationen über Krankheiten und wann man zu welcher Anlaufstelle zur Behandlung gehen kann. Bloß ist fraglich, ob die Bereitschaft zur Kooperation bei allen beteiligten Stellen ausreicht – oder ob sich die Bevölkerung weiterhin selbst durch den Dschungel des Gesundheitssystems kämpfen muss.