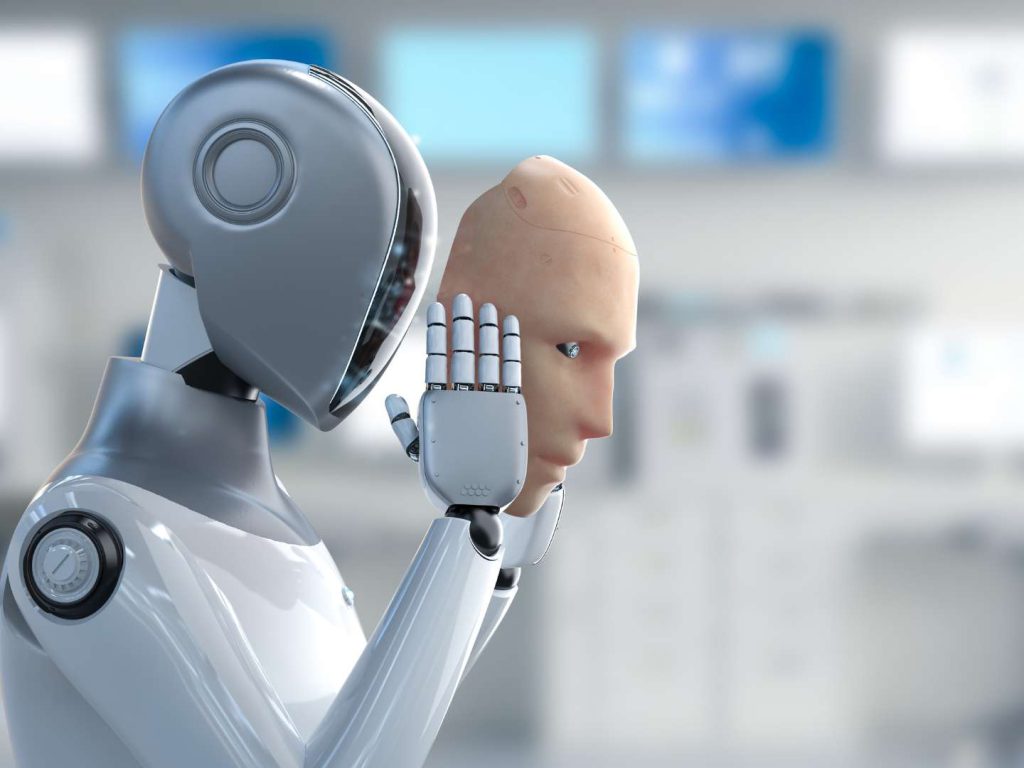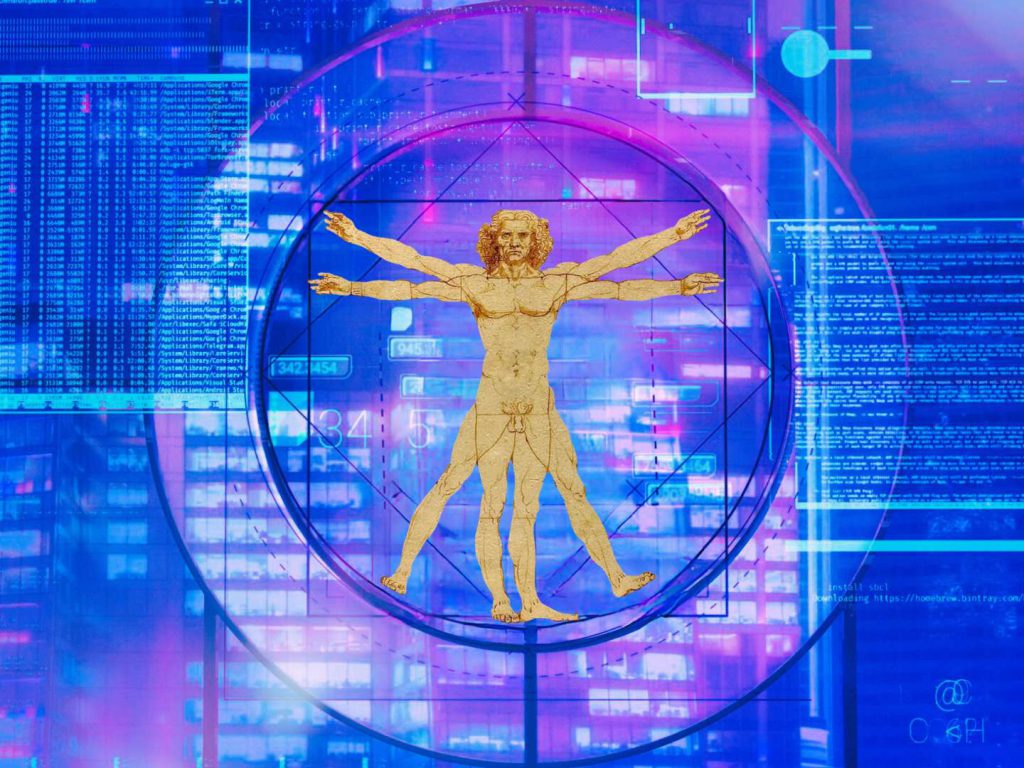Die Grenzen der Neutralität

Von Österreichs Neutralität ist heute nicht mehr viel übrig. Dennoch (oder gerade deswegen?) wird man sie bis auf weiteres beibehalten. Das ist auch nicht weiter tragisch. Eine echte Debatte zur österreichischen Sicherheitspolitik mitsamt konkreten Maßnahmen wäre wichtiger.
An der Neutralität scheiden sich die Geister. Obwohl, eigentlich nicht, erfreut sie sich doch anhaltender Beliebtheit: Laut einer Gallup-Umfrage vom Juni 2022 (um nur eine von vielen zu nennen) sind 71 Prozent der Befragten der Ansicht, dass „es für die Sicherheit Österreichs besser“ sei, „die Neutralität zu bewahren“. Nur 16 Prozent sind der Ansicht, dass ein NATO-Beitritt dazu besser geeignet sei, der Rest war unentschlossen.
Die „aktive Neutralitätspolitik“
Damit sind wir auch gleich bei einem Kernproblem der Neutralitätsdebatte: Wenn sie gerade nicht von Emotion durchdrungen und mit Plattitüden gespickt ist, wird sie als Ja oder Nein zu einem NATO-Beitritt geframt – ein durchaus wichtiger Teilaspekt, aber eben nicht alles. Was Neutralität genau bedeutet oder bedeuten soll, bleibt außen vor – zumal politische Argumente dabei oft und gerne mit rechtlichen vermischt werden.
Also fangen wir von vorne an: Österreich hat sich seit jeher dem Gedanken „aktiver Neutralitätspolitik“ verschrieben. Vor allem Bruno Kreisky verstand es, erst als Außenminister und später als Kanzler, das Land damit größer zu machen, als es tatsächlich war: „Je uneingeschränkter wir uns [zur Neutralität] bekennen, desto stärker wird die Stellung Österreichs in Europa sein, desto größer unsere Unabhängigkeit und desto sicherer unsere Freiheit“, wie er es selbst formulierte.
Damit traf Kreisky einen österreichischen Nerv. Nach dem Ende der Monarchie und der endgültigen Absage an die Idee eines „Anschlusses“ an Deutschland als größeren, mächtigeren Staat, konnte damit auf friedlichem Wege eine tief verwurzelte Sehnsucht befriedigt werden. Zeitgleich begannen mehr und mehr Menschen, sich als Teil einer „österreichischen Nation“ zu fühlen. Wie der Politologe Helmut Kramer ausführte, war das „auch auf die Steigerung des außenpolitischen Selbstwert- und Sicherheitsgefühls durch Staatsvertrag und erfolgreiche Neutralitätspolitik zurückzuführen“.
Wenn heutige Politiker das Schlagwort „aktive Neutralitätspolitik“ ins Feld führen oder versuchen, Staats- und Regierungschefs aus aller Herren Länder für Fototermine zu treffen, kommt das also nicht von ungefähr. Vielmehr knüpfen sie an eine schon lange bestehende Polit-Tradition an, Außen- mit Innenpolitik zu verknüpfen.
Schlüsseljahre: 1989, 1995 – und jetzt 2022?
Allein, der weltpolitische Rahmen hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert. Die Staatenwelt hat heute ungleich mehr Mitglieder: Gehörten den Vereinten Nationen zum Zeitpunkt ihrer Gründung 1945 noch 51 Staaten an, sind es heute 193. Das Ende des Kolonialismus ab den 1960er Jahren hat die Welt ebenso verändert wie der Zerfall der Sowjetunion. Allein deswegen würde man die „UNO-City“ heute wohl nicht mehr in Wien errichten: Dass drei von vier UN-Sitzen in westlichen Staaten liegen, ist der Geschichte geschuldet.
So leben wir heute in einer multipolaren Weltordnung, die aus einzelnen Machtblöcken besteht – allen voran den USA und China, dazu Europa oder auch, in unterschiedlichem Ausmaß, die übrigen BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und Südafrika) und weitere Regionalmächte.
Fallweise können neutrale Staaten zwar weiterhin eine Rolle spielen. Allerdings weniger als „Vermittler“ oder „Brückenbauer“, zumal das für sich stets umstritten war: Man denke an die Aufwertung der PLO, die Einladung an Muammar al-Gaddafi nach Wien oder die Nicht-Teilnahme an den Sanktionen gegen den Iran nach der Islamischen Revolution.
So geht es vielmehr darum, Räumlichkeiten bereitzustellen (man spricht dabei von „guten Diensten“). Österreichische Regierungspolitiker sitzen also nicht mit am Verhandlungstisch, sie müssen bei den Verhandlungen in diversen Wiener Nobelhotels früher oder später draußen bleiben. Ob die Neutralität eine conditio sine qua non für Gespräche wie jene zum Iran-Deal sind, lässt sich nicht sagen. Wie die Osloer Friedensverhandlungen zum Nahost-Konflikt gezeigt haben, ist selbst eine NATO-Mitgliedschaft kein absolutes Hindernis.
Die EU hat die Neutralität verändert
Wie dem auch sei, Österreich hat sich schon ab den 1980er Jahren verstärkt nach Europa und in Richtung heutige EU orientiert. Das hatte simple geografische und, damit einhergehend, wirtschaftliche Gründe: Gute zwei Drittel des österreichischen Handels entfielen auf EG-Staaten, man wollte und brauchte also Zugang zum Binnenmarkt.
Die Auswirkungen auf die Neutralität waren den Verhandlern bewusst: Der damalige Außenminister Alois Mock ging im Beitrittsgesuch von 1989 noch (im Gegensatz zu Schweden und Finnland) explizit davon aus, dass Österreich „auch als Mitglied der Europäischen Gemeinschaften … in der Lage sein wird, die ihm aus seinem Status als immerwährend neutraler Staat erfließenden rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen und seine Neutralitätspolitik als spezifischen Beitrag zur Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit in Europa fortzusetzen“.
Beim EU-Beitritt selbst gab es allerdings keine eigenen Bestimmungen zur Neutralität, Österreich übernahm sämtliche Verträge inklusive der Erklärung zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Die Verfassung wurde dementsprechend geändert (der damalige Artikel 23f B-VG, nunmehr Artikel 23j).
Damit muss Österreich beispielsweise EU-weite Sanktionen umsetzen, aus Sicht des Neutralitätsgesetzes bestanden dafür noch nie unüberwindbare Einwände: Rechtlich war und ist die Neutralität auf Kriege und kriegerische Maßnahmen beschränkt. Wirtschaftliche Boykotte fallen ungeachtet ihrer potenziell verheerenden Auswirkungen nicht darunter.
Sollte Österreich dennoch einzelne Beschlüsse blockieren, bestünde außerdem ein offener Widerspruch zu den Geboten der Solidarität und Kooperation beziehungsweise allgemein dem Gedanken einer einheitlichen Position der EU: „Gemeinsam ist man stark oder zumindest stärker.“ Allenfalls kann Österreich sich bei neutralitätspolitischen Bedenken immer noch „konstruktiv“ enthalten, den entsprechenden Beschluss also nicht offen mittragen, ohne ihn zu blockieren.
Gemeinsame Verteidigung
Ungleich komplexer sind die Auswirkungen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP), die ebenfalls von der Verfassung gedeckt ist. So bestand schon lange vor dem EU-Beitritt kein Zweifel darüber, dass das österreichische Bundesheer an Auslandseinsätzen teilnehmen darf, die durch ein UNO-Mandat gedeckt sind. Ebenso sind in solchen Fällen Truppen- und Waffentransporte oder auch Überflüge durch Kampfjets möglich. Sobald eine Autorisierung des Sicherheitsrats vorliegt, spricht man daher nicht von einem „Krieg“ – was die neutralitätsrechtlichen Verpflichtungen auslösen würde – sondern von einer (Quasi-)„Polizeiaktion“.
Derartige Mandate sind allerdings die Ausnahme. Während des Kalten Kriegs gab es lediglich ein einziges, und das auch nur, weil Russland die Sitzungen während des Koreakriegs anfangs boykottierte. Nach dem Kalten Krieg sollte die Kooperationsbereitschaft zwar zunehmen, die geschlossene Reaktion auf den irakischen Angriffskrieg gegen Kuwait galt als Beginn einer „neuen Weltordnung“ (O-Ton George H. W. Bush).
Daraus ist langfristig zwar nichts geworden, in den letzten Jahren haben der Syrienkrieg und Russlands Angriff auf die Ukraine die Defizite der Beschlussfassung des UN-Sicherheitsrats einmal mehr offengelegt. Die fünf ständigen Mitglieder können sogar dann von ihrem Vetorecht Gebrauch machen, wenn sie selbst unmittelbar betroffen sind.
Krieg im Wandel
Die Bedeutung des Neutralitätsrechts hat dennoch stark abgenommen. Schließlich bezieht es sich nur auf zwischenstaatliche Konflikte, also solche, in denen einander zwei oder mehrere staatliche Armeen gegenüberstehen. Derartige Kriege sind seit 1945 zur Ausnahme geworden, die meisten finden innerhalb von Staaten statt. Andere Länder greifen dabei zwar üblicherweise in unterschiedlicher Intensität von außen ein, etwa durch Waffenlieferungen oder die Finanzierung von bewaffneten Gruppen – die Neutralität wird allerdings erst dann schlagend, wenn sie selbst unmittelbar gegen einen anderen Staat kämpfen.
Auch bei Terrorismus kommt sie nicht zum Tragen, Österreich erlaubte nach 9/11 daher militärische Überflüge im Kampf gegen Al-Kaida und die Taliban. Jahre später schloss sich die Bundesregierung wiederum der Allianz gegen den „Islamischen Staat“ an (wobei Österreich nicht militärisch involviert war).
Neutralitätswende?
Russlands Angriff auf die Ukraine widerspricht damit einem historischen Trend, er katapultiert uns völkerrechtlich geradewegs ins Jahr 1907 zurück. Damals wurden im Rahmen der II. Haager Friedenskonferenz die allgemeinen Regeln für neutrale Staaten verabschiedet: keine Waffenlieferungen, keine Stationierung oder Durchmärsche ausländischer Truppen.
Seit damals hat sich allerdings viel getan. 1928 wurde mit dem Kellogg-Briand-Pakt der Krieg erstmals umfassend verboten, nach dem Zweiten Weltkrieg folgte in der UN-Charta ein noch umfassenderes Verbot jeglicher Form von Gewalt.
Die Neutralität sollte damit eigentlich an ihr Ende kommen, war sie doch ein Kind aus jener Zeit, in der Krieg noch als allgemein akzeptierte „Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ galt. Die Ironie will es, dass vor allem Hans Kelsen, bekanntermaßen Architekt der österreichischen Bundesverfassung, ihr schon früh eine klare Absage erteilte: Da das moderne Völkerrecht zwischen Aggressoren und sich verteidigenden Staaten unterscheidet, könne es keine Gleichbehandlung zwischen ihnen geben. Wer schweigt, stimmt der Gewalt zu. Dieser Prämisse folgend postulierten die USA schon während des Zweiten Weltkriegs ein „qualifiziertes“ Neutralitätsverständnis, das die Unterstützung der durch Nazi-Deutschland angegriffenen Staaten ermöglichen sollte.
Österreich verschrieb sich 1955 allerdings der „klassischen“ Neutralität, das Moskauer Memorandum nennt bekanntlich die Schweiz als Vorbild. Das Neutralitätsgesetz erwähnt daher auch keine Ausnahmen für die Unterstützung angegriffener Staaten. Dazu passt, dass das Bundeskanzleramt bei der Unterstützung der Ukraine extra betonte, sich nicht an der Finanzierung von „letaler Ausrüstung“ zu beteiligen.
Waffenlieferungen
Dabei handelt es sich jedoch um eine primär politische Entscheidung. Die Bundesregierung sieht auch kein grundsätzliches Problem bei Waffentransporten durch österreichisches Gebiet, das Kriegsmaterialgesetz (konkret § 3 Abs. 1a Z 2) erlaubt ausdrücklich Bewilligungserteilungen zum Transit und Export von Waffen auf Grundlage eines Beschlusses im Rahmen der GASP (was hier vorliegt).
So gesehen – und nun betreten wir besonders heikles Terrain – kann man sich fragen, ob Waffenlieferungen aus Österreich möglich wären. Allgemein-völkerrechtlich bestünde dabei kein Problem, es greift das kollektive Selbstverteidigungsrecht der Ukraine. Russland darf neben ihr auch keinen der Staaten angreifen, die sie unterstützen – ob und wann man als Kriegspartei gilt, ist dabei übrigens unerheblich.
„Bündnisfrei“ oder „Trittbrettfahrer“
Mit der ursprünglichen Neutralität wäre das freilich nicht vereinbar. Aber die ist, wie gesagt, mit dem EU-Beitritt und den späteren Reformen in der GASP aufgegangen. Die Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin aus dem Jahr 2001 bezeichnete Österreichs Status gar als „bündnisfrei“. Damit könnte man militärische Unterstützung leisten (so hat das bündnisfreie Schweden schon Ende Februar 2022 bekannt gegeben, der Ukraine unter anderem 5.000 Panzerabwehrwaffen zu liefern).
Im Lichte der EU-Beistandsklausel und der allgemeinen Fortentwicklung der gemeinsamen, EU-weiten Verteidigung ist selbst dieser Status fraglich. Die EU ist zwar nicht die NATO, aber auch kein bloßer regionaler Kooperationsrahmen wie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Daran ändert auch die „Irische Klausel“, also die ausdrückliche Rücksichtnahme auf die (Neutralitäts-)Politik einzelner Staaten, nichts. Mag es dadurch zwar keine Verpflichtung geben, anderen – angegriffenen – EU-Mitgliedern direkt mit dem Bundesheer zur Hilfe zu kommen, darf es im Falle eines Falles auf militärische Unterstützung zählen. Das kann man als „asymmetrisches Verteidigungsbündnis“ oder aber auch als „Trittbrettfahrertum“ bezeichnen. Führt man sich die Bedeutung der NATO in der europäischen Sicherheitspolitik vor Augen, muss Österreich sich außerdem den Vorwurf der „Made im NATO-Speck“ gefallen lassen.
Österreich darf mehr, als es will
Das wird bis auf Weiteres so bleiben. Auch nach dem 24. Februar ist es zu keinem Umdenken in Sachen Neutralität gekommen. Im Gegenteil, eine Abänderung des Neutralitätsgesetzes oder gar ein NATO-Beitritt sind so unrealistisch wie eh und je.
Gleichzeitig scheinen die rechtlichen und politischen Auswirkungen des EU-Beitritts in weiten Teilen der Bevölkerung immer noch nicht angekommen zu sein. Immerwährende Neutralität bedeutet selbstauferlegte Einschränkungen für zukünftige und gegenwärtige zwischenstaatliche Kriege. Das gilt in dieser Strenge schon lange nicht mehr: Im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik kann Österreich – sowohl verfassungs- als auch völkerrechtlich – mehr tun, als es eigentlich möchte.
RALPH JANIK ist Universitätslektor mit Schwerpunkt Völkerrecht, Menschenrechte und Recht des Welthandels. Auf seiner Website beschreibt er sich als „ewig strebend bemüht, die Brücke zwischen Wissenschaft und interessierter Öffentlichkeit zu schlagen“.