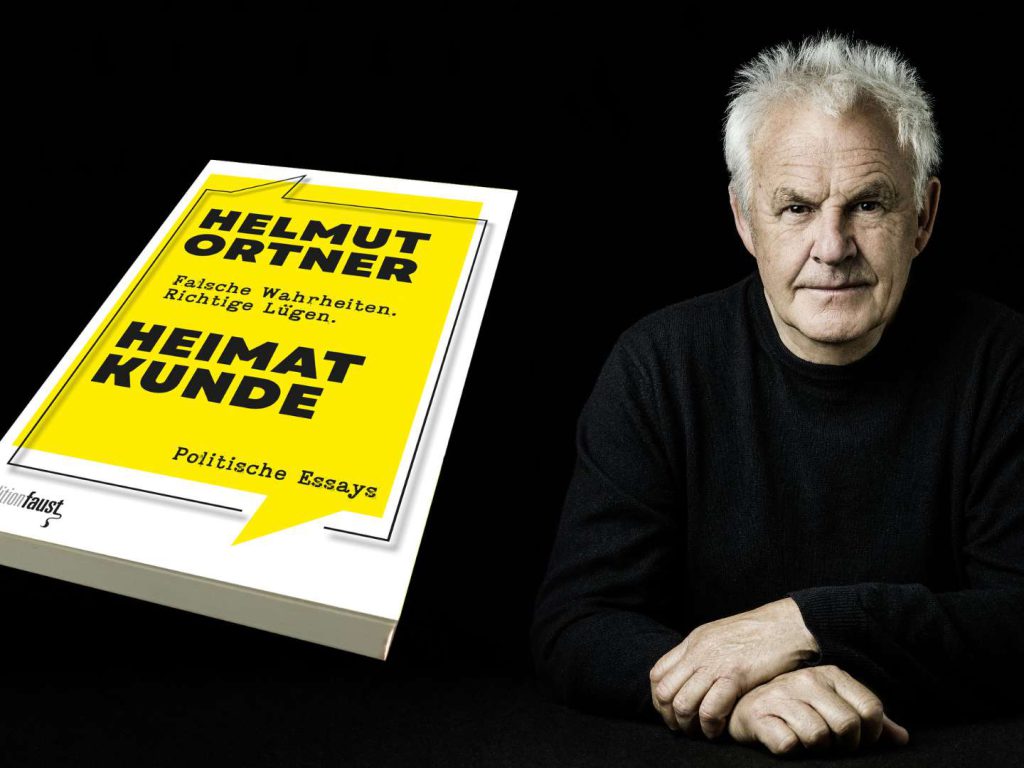Gerald Loacker: „Der Staat zieht den Bürgern zu viel aus der Tasche“

Das Thema Entlastung ist in diesem Jahr besonders präsent. Die Prognosen des Bundesbudgets sind allerdings düster, denn das Defizit steigt, und die Regierung verteilt weiter fleißig Wahlzuckerl, anstatt den Haushalt endlich auf ein stabileres Fundament zu stellen. Und dann wäre da noch die Sache mit den Pensionen. Materie hat im Interview mit NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker über die Themen Inflation, Entlastung und das reformbedürftige Pensionssystem gesprochen.
Derzeit wird wieder über die Ausschüttung des Klimabonus diskutiert. Welche Folgen haben solche Einmalzahlungen für das Nachfrageverhalten und in Konsequenz für die Inflation?
Für viele Empfänger des Klimabonus ist diese Zahlung im Moment ein zusätzliches Einkommen, das direkt in die Nachfrage fließt: ein Thermenwochenende, ein Tattoo, eine neue Hose. Natürlich heizt diese Form von Helikoptergeld die Inflation an.
Blicken wir auf die EZB. Diese versucht seit einiger Zeit, die Inflation einzudämmen. Wie kommen diese Maßnahmen aus Frankfurt in Wien an?
Die Fiskalpolitik der Regierung mit ihrer großzügigen Ausgabenpolitik konterkariert die restriktivere Geldpolitik der EZB, die mit höheren Zinsen und einem Ende des QE (Quantitative Easing) eher die Nachfrage dämpfen will. Nur wirkt Fiskalpolitik viel unmittelbarer. Das erklärt auch, warum Österreich über weite Strecken eine höhere Inflation hatte als andere Staaten der Eurozone.
Was bräuchte es statt der Gießkannenpolitik für Entlastungsmaßnahmen, die spürbar bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen, aber keine weiteren Löcher ins Budget reißen?
Mit einer Abgabenquote von über 43 Prozent zieht der Staat den Bürgern zu viel aus der Tasche. Einen kleinen Teil davon steckt er uns über Gießkannenzahlungen wieder zu. Besser wäre es, die Steuern generell zu senken, damit den Menschen mehr vom Erarbeiteten übrigbleibt. Das betrifft die zu hohe Lohn- und Einkommensteuer genauso wie Kammerbeiträge oder Beiträge unter dem Titel „Wohnbauförderung“, die unsere Bundesländer nur zu einem Bruchteil fürs Wohnen ausgeben.
Kritiker von Senkungen der Lohnnebenkosten führen oft zwei Argumente an: Es gehen Leistungen für Arbeitnehmer verloren, die dringend notwendig sind, und eine Senkung der Lohnnebenkosten führt nicht zwangsläufig zu höheren Löhnen. Was würdest du diesen beiden Argumenten entgegnen?
Zu den Lohnnebenkosten gehört beispielsweise die Wirtschaftskammerumlage 2. Die geht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genau gar nichts an. Eigentlich müsste die Gewerkschaft sagen: „Wie kommen unsere Arbeitnehmer dazu, mit ihrem Arbeitslohn die Wirtschaftskammer zu finanzieren?“ Oder der Wohnbauförderungsbeitrag, der ein Prozent von jedem Lohn ausmacht: Er fließt im Schnitt zu 37 Prozent in Wohnbau. Der Rest versickert in den Budgets der Bundesländer.
Auf der anderen Seite betrifft zum Beispiel der Arbeitslosenversicherungsbeitrag schon die Arbeitnehmer. Aber warum kostet die Arbeitslosenversicherung in Österreich doppelt so viel wie in Deutschland und fast dreimal so viel wie in der Schweiz? Weil wir mit dem Geld viele Dinge finanzieren, die nice to have sind, die Bildungskarenz zum Beispiel, die 70 Prozent der Frauen zur Verlängerung von Elternkarenz nützen. Dafür sind aber Arbeitslosenversicherungsgelder nicht gedacht.

Gerald Loacker vor dem Arbeits- und Sozialausschuss mit Michael López
Das Pensionssystem in Österreich ist vor allem eines: teuer. Welche Maßnahmen bräuchte es, damit der Bund nicht jedes Jahr mehr Geld zuschießen muss, um die Pensionen zu sichern?
Zuerst müssen die Regierungen damit aufhören, jedes Jahr zusätzlich zur Inflationsabgeltung noch Geschenke an die Pensionistinnen und Pensionisten zu verteilen, die dann jahrzehntelang zu zahlen sind. In Zukunft könnte man beim Frühstarterbonus, zusätzlichen Pensionserhöhungen im ersten Pensionsjahr, der außertourlichen Aufwertung der Pensionskonten und dergleichen jährlich mehr als eine Milliarde einsparen.
Dann gehört die steigende Lebenserwartung im Pensionssystem abgebildet. Die Österreicher gehen im selben Alter wie 1970 in Pension, sie leben aber viel länger. Durch die steigende Lebenserwartung wird ein Beitragseuro im Pensionssystem jedes Jahr mehr wert. Das kann eine Pensionsautomatik wie in Schweden ausgleichen.
Außerdem ist es zu leicht, eine Pension zu bekommen: Es genügen nämlich sieben Beitragsjahre aus eigenem Erwerb. Dieser Wert gehört dringend angehoben.
Was macht Schweden bei den Pensionen besser als Österreich?
Schweden bildet die Faktoren Lebenserwartung und Demografie im Pensionssystem automatisch ab, ohne dass jedes Jahr das Gesetz geändert werden muss. Die betriebliche Altersvorsorge ist flächendeckend ausgebaut, sodass alle Erwerbstätigen eine kapitalgedeckte Pension aus der sogenannten zweiten Säule bekommen. Darüber hinaus ist die erste Säule, also die staatliche Pension, zwischen Umlageverfahren und Kapitaldeckung aufgeteilt. So profitieren die Schwedinnen und Schweden von der langfristigen Entwicklung der Wertpapiermärkte.
Außerdem kann man in Schweden in „Teilpension“ gehen, also beispielsweise mit 62 einen Teil seiner Pension abrufen, daneben weiterarbeiten. Den zweiten Teil der Pension ruft man dann vielleicht mit 67 ab – zu besseren Konditionen, weil weiter Beiträge geflossen sind und Abschläge entfallen.
Man liest häufig, dass ein aktienbasiertes Pensionssystem aufgrund der Schwankungen am Kapitalmarkt viel risikoreicher ist als das hiesige Modell. Hält dieses Argument der Realität stand?
Schweden hat sein System 1994 gestartet. Seither sind die Dotcomblase 2000/01, die Finanz- und Schuldenkrise 2008 und die COVID-Krise 2020 an uns vorbeigezogen. Der Staat musste in dieser Zeit einmal zuschießen, während Österreich jedes Jahr Milliarden zuschießen muss.
Was passiert mit diesem System, wenn ein Staat wirklich einmal ins Wanken gerät, wie beispielsweise während der Finanzkrise?
Wenn eine Krise sogar den Staat zum Wanken bringt, ist das Umlageverfahren gefährlicher, weil es ohne staatliche Zuschüsse nicht funktionieren kann. In Österreich würden jedes Jahr 30 Milliarden Euro fehlen. In der Kapitaldeckung könnte im Extremfall eine Kürzung von Leistungen eintreten. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Effekt im Folgejahr vorbei und die Verluste zu einem guten Teil wieder aufgeholt sind.
Der Generationenvertag bröckelt – demografisch bedingt – weiter und weiter. Immer mehr Menschen nehmen daher die Altersvorsorge selbst in die Hand und investieren in Aktien und ETFs. Welche Maßnahmen sollte eine künftige Bundesregierung setzen, um diese Art der Geldanlage attraktiver zu machen?
Der wichtigste Schritt wäre, die Kapitalertragsteuer (KESt) auf Wertpapiergewinne wieder abzuschaffen, wenn jemand ein Papier länger als zwölf Monate behält. Jetzt besteuert der Staat die nominelle Wertentwicklung eines Papiers. Wenn ich zum Beispiel eine Aktie um 100 Euro kaufe und in zehn Jahren um 130 Euro verkaufe, muss ich die Differenz von 30 Euro versteuern, ohne dass die Inflation berücksichtigt wird. Damit zahlen Wertpapieranleger Steuer auf die Substanz. Diese Form der Besteuerung sollte nur für kurzfristige Investments bis zwölf Monate zur Anwendung kommen, sonst behandelt der Staat den langfristigen Anleger gleich wie den Zocker an der Börse.
Welchem vertagten Antrag trauerst du besonders nach, weil er mit wenig Änderung viel Verbesserung gebracht hätte?
Mein Antrag, für Kammermitgliedschaften ein Opt-out einzuführen, hätte mit wenig Aufwand die größte substanzielle Änderung für die Republik bedeutet.
Welche Behandlung würdest du dem „Patienten Pensionssystem“ verschreiben?
So wie die Schweiz bräuchten wir eine Zielsetzung, bis wann wir Beiträge und Leistungen in ein Gleichgewicht bringen. Die Schweizer AHV muss bis 2050 ausgeglichen bilanzieren. Wenn wir diesen Zielwert haben, können wir die Maßnahmen auf dem Weg dahin – also Einpreisung der Lebenserwartung, Splitting, Mindestanzahl Beitragsmonate usw. – festsetzen.