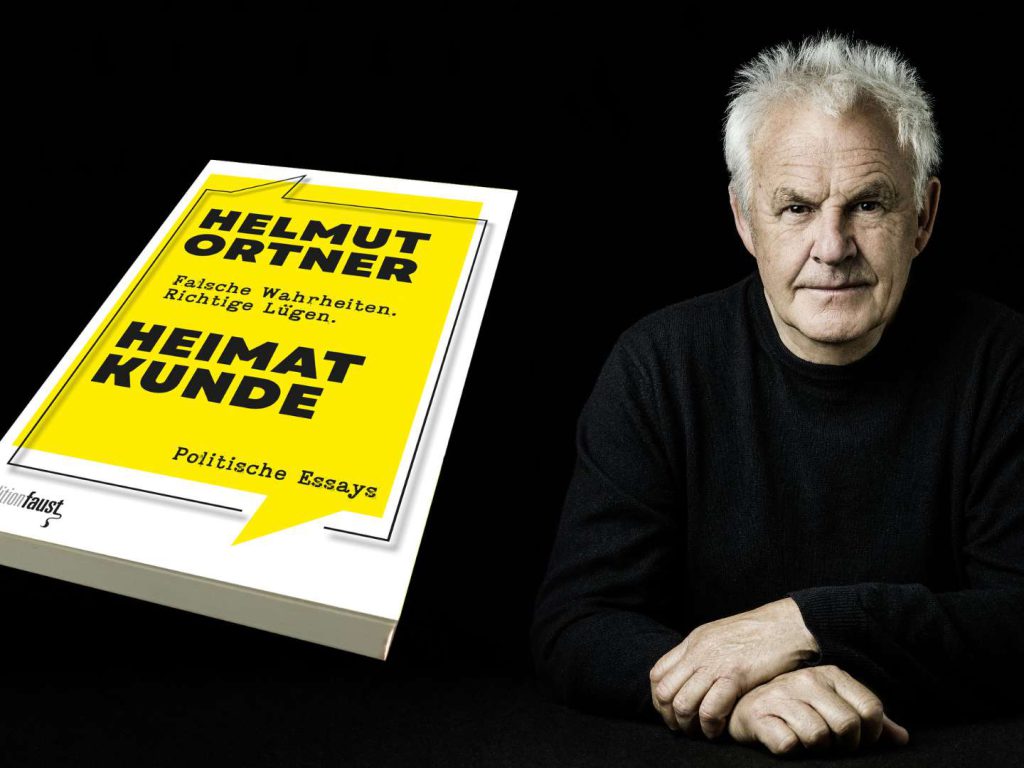Wolfgang Mazal: „Das ist ein Bruch des Generationenvertrags“

Die Jungen? Wollen nichts mehr arbeiten. Die Alten? Sitzen auf ihren Privilegien. Wer dieser Logik folgt, befindet sich in einem Generationenkonflikt – obwohl oft diskutiert wird, ob es ihn überhaupt gibt. Wenn man Verteilungs- und Kulturfragen betrachtet, liegt das zumindest nahe.
Wolfgang Mazal ist Experte im Bereich Arbeits- und Sozialrecht und Leiter des Österreichischen Instituts für Familienforschung. Mit ihm sprechen wir über den Generationenkonflikt, das Pensionssystem und die Frage, ob es heute noch ein Aufstiegsversprechen für die Jungen gibt.
Sehen Sie so etwas wie einen „Generationenkonflikt“ in Österreich?
Ich sehe einen Generationenkonflikt, er wird allerdings nicht offen ausgetragen. Er besteht aus meiner Sicht darin, dass die Generation der Babyboomer nicht nur einen schönen Sozialstaat hinterlässt. Sie hat weniger Kinder in die Welt gesetzt und kommt in den Genuss einer deutlich höheren Lebenserwartung. Dadurch geben sie eine viel größere Last weiter – verschärft vor allem durch die Staatsschulden, die sie aufgebaut haben.
Was meinen Sie, wenn Sie von Last sprechen?
Es ist einerseits die ökonomische Belastung, die durch Staatsschulden, Zinsen usw. kommt. Aber geht auch darum, dass der nächsten Generation viele Probleme ungelöst hinterlassen werden. Gleichzeitig hat sich auch das Mindset verändert: eine sehr starke Staatsgläubigkeit, ein geringes Bewusstsein an Eigenverantwortung und ein geringes Vertrauen in die Zukunft. Das Mindset, das hinterlassen wird, ist nicht zukunftsfähig.
Woher kommt diese Staatsgläubigkeit der Boomer?
Die kommt daher, dass diese Generation durch die Ära Kreisky geprägt wurde, in der der Staat als „Lösungsmaschine“ für alle sozialen Probleme positioniert wurde. Das sehen wir fast täglich in den Headlines der Medien: Wo immer es ein Problem gibt, kommt der Vorwurf, die Politik habe versagt. Niemand sagt mehr, die Menschen sollen das selbst in die Hand nehmen.
Oft reden wir über Generationen anhand von Verteilungsdebatten, vor allem im Zusammenhang mit den Pensionen. Liegt da zu viel Geld bei den Alten?
Im öffentlichen Haushalt sieht man sehr schön, dass der Aufwand für Lasten aus der Vergangenheit – und das sind nun mal auch die Pensionen – deutlich größer sind als Investitionen in die Zukunft, zum Beispiel im Bildungssystem. Ich war im Jahr 2000 zu einem Vortrag im Rechnungshof eingeladen, und der Titel war für mich sehr befremdlich: „Wozu sparen im Sozialbereich?“ Ich habe meine These vertreten, dass wir an und für sich sehr viel Geld im Haushalt haben und uns alles leisten können. Aber was wir uns nicht leisten konnten, und das hab ich damals schon gesagt: die erkennbar hohen Ausgaben für die Zukunft. Damals war das Pflege, Bildung, „Inkulturation“, also das Integrations-Thema, aber auch innere und äußere Sicherheit. Und jetzt haben wir keine Spielräume für all diese Themen, die auf uns zugekommen und heute manifest sind. Diese Verweigerung des Nachdenkens über die Zukunft der öffentlichen Ausgaben – das ist ein Bruch des Generationenvertrags.
Liegt das Problem darin, dass sich keine Bundesregierung trauen kann, in einem staatsgläubigen Land ehrlich zu sagen, dass man sich etwas nicht leisten kann?
Das ist aus meiner Sicht eine Frage der Verantwortung von Politikern. Wenn Politiker nur parteipolitisch denken, werden sie sich das nicht trauen. Aber wenn sie endlich in einer großen Frage der Zukunft an einem gemeinsamen Strang ziehen würden, wäre das möglich. Das sehe ich aber momentan nicht.
Warum ist das Pensionssystem eigentlich so teuer?
Das Pensionssystem ist deswegen teuer, weil wir glücklicherweise ein hohes Pensionsniveau haben, das ist keine Frage. Aber wir nehmen auch keine Rücksicht auf die steigende Lebenserwartung. Das Pensionsalter von 65 wurde erstmals im Jahr 1906 geschaffen, mit der Begründung: Das können wir uns leisten, denn das erleben nur 10 Prozent der Menschen. Jetzt ist klar, dass sich die Welt seit damals verändert hat. Wir haben hohe Produktivitätsgewinne, da muss man nicht bei 10 Prozent bleiben, weil wir Fortschritte gemacht haben. Aber dass das Pensionsalter niedriger ist als damals, aber die Lebenserwartung höher – das ist ein kühner Ansatz.
Wenn man über Pensionen redet, kommt bei vielen reflexartig der Verdacht auf, man will sie kürzen oder beschließen, dass alle länger arbeiten. Kann man das System nicht anders sanieren?
Unser System geht von „One size fits all“ aus. Das ist der Realität aber nicht angemessen. Es gibt Menschen, die sind beruflich ausgelaugt und können nicht länger im Erwerbssystem stehen. Gleichzeitig gibt es aber auch mehr Menschen, die länger im Erwerb bleiben können, und sei es auf Basis eines qualifizierten Teilzeitjobs. Die können damit weiter ins Pensionssystem einzahlen, oder eben einzahlen und nicht die volle Pension herausnehmen. Da gibt es viele Varianten. Aber wenn irgendwo eine Gruppe anders behandelt wird als eine andere, wird geschrien, das sei unfair.
Sie meinen also, wenn jemand mit 55 körperlich nicht mehr arbeitsfähig ist, sagen 65-Jährige, sie haben mehr gearbeitet und mehr verdient?
Ja. Aber ich würde bei denen, die mit 55 physisch kaputt sind, früher ansetzen: Es sollte niemand so lange in Tätigkeiten erwerbstätig sein, die ihn frühzeitig pensionsreif machen. Hier gehört ein Lifelong-Learning-Prinzip her. Eine Vorstellung wäre, es wird jeder mit 35 vom AMS angeschrieben mit „Überlegen Sie, was Sie mit 45 für einen neuen Beruf machen“. Aber 40 Jahre Krankenpflege, Bauarbeiter, das ist klar, das geht nicht mehr. Aber es gibt so viele Tabus in der Republik, dass man damit nur schwer weiterkommt.
Ist das nicht ein optimistischer Ansatz, dass dieses Angebot viele annehmen würden? Für viele dürfte das Modell ja nach wie vor sein, einen Beruf zu erlernen und den dann auf absehbare Zeit zu machen, vielleicht auch für immer.
Es haben tatsächlich viele in Österreich das lebenslange Lernen nicht umgesetzt, auch Unternehmen. Wir haben eine sehr statische Vorstellung von der Arbeitswelt. Ausgenommen Junge: Denen sagen wir, sie werden in ihrem Leben sechs oder sieben Berufe machen müssen. Aber dann haben sie den ersten Job und denken dann, das ist es jetzt. Und das ist einfach falsch. Das ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit.
Wie könnte man das ändern?
Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe: die Prägung des Mindsets. Und wenn die Politik schon nicht vorangeht, sollte sie zumindest nicht gegensteuern. Aber wenn man heute etwas am Mindset ändern will, ist man asozial, rückständig oder sonst was.
Haben Sie ein Beispiel dafür?
Zum Beispiel eine moderate Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters. Die wird für per se als asozial erklärt. Und das ist meiner Meinung nach sachlich nicht richtig. Es gibt andere Länder, in denen es das gibt, etwa die Niederlande. Und dort sieht man: Wenn die Menschen die Sicherheit haben, dass sich das System an Veränderungen anpassen kann, haben sie Vertrauen ins System. In Österreich hat man dagegen den Eindruck, das System ist statisch und bleibt so – und die Jungen verlieren das Vertrauen.
Das bringt mich ganz gut zur nächsten Frage, die ich stellen wollte. Auf der einen Seite haben wir also das Pensionssystem, das hohe Budget für Pensionen. Und auf der anderen Seite gefragt: Fehlt den Jungen nicht auch das Aufstiegsversprechen?
Das Aufstiegsversprechen ist ein relativ junges Phänomen. Das ist letztlich die Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, die das erlebt hat. Historisch war es nicht so: Da gab es stabile, statische Lebensverhältnisse. Nicht allen wurde versprochen, sie werden Generaldirektor, und dann sind sie es geworden. Die meisten haben sich durch dieses Versprechen auch nicht verführen lassen. Den meisten ging es um einen guten Job und hoffentlich gute persönliche Beziehungen, und dann waren Menschen zufrieden. Aber durch ein Aufstiegsversprechen, das nicht erfüllt wird, entsteht massenhaft Unzufriedenheit. Und das ist hinderlich im Lebensglück.
Aber glauben Sie, dass es Aufgabe der Politik wäre, dieses Aufstiegsversprechen zu geben? Oder müssen wir uns darauf einstellen, dass es das war?
Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass das eigentliche Ziel des Lebens Zufriedenheit ist. Da wird sich der eine ein Aufstiegsmodell vorstellen, und der andere wird sagen, ich brauche keinen Aufstieg, solange ich gut zurechtkomme. Aber es ist nicht die Aufgabe der Politik, ein Versprechen zu geben, das sie nicht halten kann.
Klar, nur die Rhetorik reicht nicht. Aber hat das nicht auch Folgen, wenn dieses Versprechen nicht mehr gegeben wird? Auch der Kinderwunsch geht ja bekanntlich zurück.
Das sagt man gemeinhin so, aber ich halte das nicht für ganz zutreffend. Die Zinslast für Privatkredite und die Inflation waren in den 70er Jahren höher, aber die Menschen haben trotzdem gesagt, ich packe es an. Diese Generation hat dann aber keine Kinder in die Welt gesetzt, weil sie den Spagat zwischen Kindern und Karriere nicht geschafft hat. Das hatte aber nichts mit dem Aufstiegsversprechen zu tun, im Gegenteil. Die heutige Generation sieht, dass sich dieser Spagat zwischen „Totalerwerbstätigkeit“ und Familienleben eben nicht immer ausgeht. Die sagen dann zu ihren Eltern: „Ich will nicht so werden wie ihr“. Sie haben mitbekommen, dass die Babyboomer ihre Beziehungen nicht hingekriegt haben, gerade Scheidungskinder. Oder die ihre Eltern kaum gesehen haben und jetzt sagen: „Wenn ich schon Kinder habe, dann will ich etwas von ihnen haben.“
Was wiederum in aktuelle Debatten über die Arbeitswelt hineinspielt.
Genau, das führt dazu, dass wir in einem geflügelten Wort der Personalarbeit einen klassischen Fehler unseres Mindsets sehen: Im Begriff „Work-Life-Balance“. Hier wird Arbeit als Gegenort des Lebens definiert – und das ist einfach falsch. Wenn man sieht, dass Arbeit ein Teil des Lebens ist, stellt sich die Frage, was ist der andere Teil: Und das ist die Freizeit, Zeit für die Familie. Wenn junge Menschen heute 30 bis 35 Stunden arbeiten und 40 in Stoßzeiten, und dann sagen Personalisten, die sind faul, dann ist das falsch, denn das ist eigentlich ein vernünftiges Vollzeitangebot. Und ich sage den Personalisten immer: Sagt nicht, die sind nicht arbeitsbereit, sondern sagt, die sind sozialkompetent. Denn die wollen ein Leben in neuen Balancen führen.
Darauf werden Sie wahrscheinlich gemischte Antworten kriegen.
Durchaus positive. Denn das führt zur Reflexion. Die Jungen sind auch nicht besonders gierig danach, dass das mit vollem Lohnausgleich passiert. Sie wissen, dass sie weniger verdienen werden, aber sie wissen und spüren auch, dass sie sich den Wohlstandsverlust durch Scheidung ersparen. Denn Scheidung bedeutet ja nicht nur menschliche Themen und Anwaltskosten, sondern auch Wohlstandsverlust. Statistisch schätzt man bis zu 30 Prozent Wohlstandsverlust für das Paar, weil die Synergien des gemeinsamen Haushalts verlorengehen.
Wenn Sie sagen, dass „Work“ und „Life“ nicht mehr getrennt sein sollte: Bedeutet das nicht auch mehr Kinderbetreuung?
Nicht unbedingt. Work-Family-Balance bedeutet, dass man die Erwerbsarbeit lebensphasenbasiert gestalten müsste. In einer Zeit, in der man ein kleines Kind hat, wollen junge Menschen, insbesondere junge Mütter, oft eher beim Kind bleiben. Und dann sollte man ihnen einen guten Wiedereinstieg ermöglichen. Der Betriebskindergarten ist für viele auch nicht das Mittel der Wahl – wenn der Arbeitsplatz nicht hält, ist die Kinderbetreuung weg. Kinderbetreuung im lokalen Wohnumfeld ist das Mittel der Wahl. Die Firmen können lokale Kindergärten fördern, dem Bürgermeister sagen, hier ist steuerfreies Geld, da kommt eine Mitarbeiterin von mir vorbei und hilft. Aber all das wurde nicht angenommen, weil man falsche Rezepte predigt, ohne sich mit den Lebensrealitäten zu beschäftigen.
Also wäre ein flächendeckender Ausbau der Kinderbetreuung besser als mehr Betriebskindergärten.
Genau.
Aber der Ausbau geht nur schleppend voran.
Nein, gar nicht so schleppend. Wir haben in den letzten zehn Jahren teilweise eine Verdrei- bis Vierfachung auf Landesebene geschafft. Aber man braucht eben auch das elementarpädagogische Personal, das in diesen Kindergärten arbeitet. Ich bin auch sehr besorgt über die momentanen Pläne. Man verspricht den Menschen, dass in drei bis vier Jahren alles da ist, aber das bedeutet 20.000 zusätzliche Elementarpädagogen. Wo nehmen wir die her? Qualitativ hochwertige Betreuung braucht viele Arbeitskräfte – und das sehe ich momentan nicht im öffentlichen Bereich. Wir haben nicht mal genug Lehrkräfte und Gefängnispersonal.
Einmal noch zurück zum Meta-Thema, wir haben jetzt über Pensionen und das Aufstiegsversprechen geredet. Wie vermittelt man denn in diesem Generationenkonflikt, den Sie sehen?
Man muss beiden Seiten reinen Wein einschenken und wertschätzend kommunizieren. Es geht nicht darum, die Lebensleistung der Älteren schlechtzumachen und auch nicht darum, allen Jungen auszurichten, dass sie nicht leistungsbereit sind. Wir verstehen euch, aber wir müssen darauf schauen, wie wir weiterkommen.
Und diese Nachricht würde ankommen? Oder ist da die Staatsgläubigkeit zu groß?
Ich glaube schon noch an die Vernunft und an die Vermittlung von Argumenten. Und ich würde mir wünschen, dass die Politik das wenigstens nicht konterkariert, sondern unterstützt. Die Politik allein wird das nicht schaffen – aber es würde schon helfen, wenn nicht immer dagegengearbeitet wird. Ein guter Weg in die Zukunft steht uns offen. Ich wäre ein schlechter Katholik, würde ich das anders sehen. Aber das enthebt uns nicht von der Verantwortung, selbst aktiv zu werden.