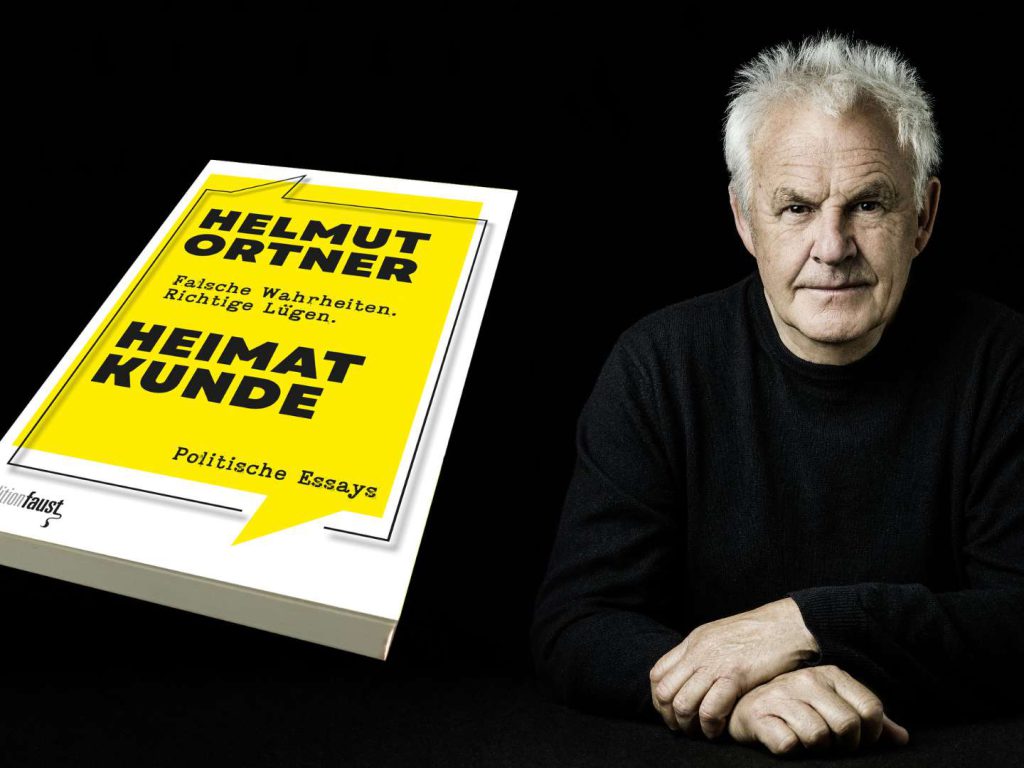Gerald Loacker: „Wir besteuern die Mittelschicht, als ob alle Großverdiener wären“

Gerald Loacker ist NEOS-Sprecher für Wirtschaft, Arbeit und Soziales. Ein Gespräch darüber, was in der Wirtschaftspolitik und am Arbeitsmarkt getan werden muss.
Wir sehen aktuell eine Abkühlung am Arbeitsmarkt, im April und Mai stieg die Zahl der Arbeitslosen erstmals wieder, gleichzeitig werden die offenen Stellen weniger. Ist der Aufschwung, den wir am Arbeitsmarkt nach Corona gesehen haben, vorbei?
Es zeigen sich die ersten Dämpfer, ja. Ich halte es noch nicht für besorgniserregend, weil die offenen Stellen viel höher sind als vor der Corona-Krise. Der Arbeitskräftemangel ist die wesentlich größere Sorge.
Die Zahl der offenen Stellen ist ja weiter hoch, auch wenn sie leicht sinkt. Wieso ist das aktuell die größere Sorge?
Das ist deshalb ein Problem, weil Unternehmen Aufträge nicht aufnehmen und bearbeiten können. Das bedeutet, dass Unternehmen nicht wachsen können, dass Aufträge damit statt an heimische Betriebe ins benachbarte Ausland wandern, das hemmt das Wachstum. Aber wir brauchen Wachstum, weil es auch technologischen Fortschritt schafft, der wiederum für eine Absicherung des Wohlstands und für neue Jobs sorgt.
Neue Technologien, aber auch der Arbeitskräftemangel bedingen aber, dass wir als Gesellschaft auch neue Fähigkeiten brauchen, um einen Job zu finden. Da sind wir beim Thema Requalifizierung und lebenslangem Lernen.
Ja, Arbeitskräfte müssen sich bewusster werden, dass sie, dass wir uns auch fit für den Arbeitsmarkt halten. Was muss ich tun, wenn ich 30, 40, 50 bin, damit ich die nächsten zehn Jahre noch einen guten Job für mich finde. Weiterbildung, lebenslanges Lernen – das ist etwas, wovon wir NEOS überzeugt sind. Das heißt auch, dass die Unternehmen aufgefordert sind, mit ihrer Belegschaft zu arbeiten. Das funktioniert aktuell gut, weil sie es müssen, weil ihnen die Arbeitskräfte ausgehen, aber das sollte strukturierter werden. Da sollte auch die öffentliche Hand mitarbeiten, dass es da einen wirklichen Sinneswandel in der Gesellschaft gibt. Bei der Requalifizierung von Arbeitslosen müssen in Zukunft die richtigen Schwerpunkte gesetzt werden, damit diese Menschen eine Chance auf einen Job in einer zukunftsfitten Branche finden.
Wie soll so ein Sinneswandel für lebenslanges Lernen denn aussehen?
Wir schlagen das Bildungskonto vor, damit jeder Mensch auch die Möglichkeit hat, sich immer weiter zu bilden. Das heißt, dass man einen Teil der Beiträge aus der Arbeitslosenversicherung für sich selbst auf einem Bildungskonto ansparen und sich damit eine Fortbildung finanzieren kann. Man kann vom Arbeitsmarktservice nicht erwarten, dass es die Personalentwicklung für vier Millionen Erwerbstätige übernimmt und Bildungskarrieren schnitzt – das ist nicht der Job der öffentlichen Hand. Die muss den Weg ebnen, dass jede und jeder eine eigene Verantwortung für sich selbst wahrnehmen kann.
Wenn man in die Arbeitslosigkeit doch hineinrutscht, braucht man die öffentliche Hand, bis man wieder einen Job findet. Ist das aktuelle System da noch zeitgemäß?
Wir leisten uns eine extrem teure Arbeitslosenversicherung. In Österreich ist der Beitrag dafür 6 Prozent, in Deutschland bei 2,6 und in der Schweiz bei 2,2. Wir zahlen mehr als doppelt so viel wie deutsche Erwerbstätige, weil wir uns unglaublich viele und unglaublich große Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung genehmigen. Ich würde lieber mehr Geld bei jenen lassen, die arbeiten und diese Beträge erwirtschaften müssen – und ein bisschen strenger drauf schauen, was wir damit eigentlich alles finanzieren.
Wie soll das konkret gehen?
Bestes Beispiel ist ein Arbeitslosengeld, das mit der Zeit sinkt. Das ist international Standard, nur in Österreich nicht. Wir sind das einzige Land in der EU, in dem die Leistung aus der Arbeitslosenversicherung keine zeitliche Grenze kennt: Ich kann die Notstandshilfe auch 10 oder 20 Jahre beziehen. Und damit ist die Gefahr gegeben, dass die eine oder der andere die Arbeitslosigkeit auf die leichte Schulter nimmt, weil es eh kein zeitliches Limit gibt. Die Betroffenen erkennen dann nicht, das jeder Monat in der Arbeitslosigkeit den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt schwieriger macht.
Würde das reichen, oder denkst du da an eine größere Reform?
Unsere Vorschläge würden für jene, die zwischen zwei Jobs kurz arbeitslos sind, wenig ändern. Die würden sogar ein bisschen besser aussteigen, weil wir das Arbeitslosengeld am Anfang erhöhen würden. Aber es wäre eine große Reform in Hintergrund, weil unsere Vorschläge Geld hin zu jenen umschichten würden, die die Beiträge erwirtschaften. Und es würde jene betreffen, die schon sehr lange schon in der Arbeitslosigkeit sind.
Menschen sollten wissen: Ich hatte Pech, ich bin arbeitslos, aber ich werde gut aufgefangen. Aber dieses „gut auffangen“ hat eine zeitliche Grenze, weil in drei Monaten sinkt mein Arbeitslosengeld um 10 Prozent, und in nochmal drei Monaten sind es nochmal 10 – und dann muss ich schauen, dass ich was finde. Bevor da jetzt aber die große Panik ausbricht, muss man ja auch bei uns immer die zweite soziale Absicherungsform berücksichtigen: Wir leisten uns ja mit der Sozialhilfe ja ein zweites Sicherungssystem. Und die ist in den letzten Jahren so exorbitant erhöht worden, dass inzwischen die Sätze aus der Sozialhilfe höher sind als das, was man aus der Arbeitslosen bekommt. Darum stocken viele ihre Notstandshilfe mit der Sozialhilfe auf. Der Rechnungshof sagt da zurecht: Wieso werden Betroffene da zu zwei Behörden geschickt? Wieso leistet sich der Staat da zwei parallele Systeme?
Deshalb wollen wir, dass nach zwei Jahren mit Arbeitslosengeld die Person in die Sozialhilfe übergeführt wird. Weil wenn das AMS es in zwei Jahren nicht schafft, die Person in Arbeit zu bringen, wird es danach wohl auch nicht funktionieren. Damit wird auch die Arbeitslosenversicherung entlastet, und man könnte den Beitrag senken. Wir müssen Menschen, die die Arbeit verloren haben und fähig sind zu arbeiten, schon ein bisschen daran erinnern, dass es auch eine Verantwortung gibt, sich zu bemühen, einen neuen Job zu finden.
Die Zahl der offenen Stellen sollte dann mit der Reform auch sinken, weil mehr Menschen wieder dazu motiviert werden, einen Job zu finden?
Teilweise ja, aber hier laufen ein paar Entwicklungen parallel ab, für einige kann die Regierung etwas, für andere nicht. Ein Beispiel ist der demographische Wandel: Im Schnitt gehen pro Jahr 100.000 Menschen in Pension und 80.000 rücken auf den Arbeitsmarkt nach. Dadurch entsteht über die Jahre ein Rückgang von verfügbaren Arbeitskräften. Die Corona-Krise hat zusätzlich mit Kurzarbeit und Homeoffice auch bewirkt, dass viele Menschen die Arbeitszeit ein wenig kürzen, auch dadurch ist das Arbeitskräfteangebot zurückgegangen. Da spielten die langen, sehr großzügigen Kurzarbeitsförderungen der Regierung sicher eine Rolle. Und seit Corona sehen wir auch, dass weniger Saisonarbeiter in allen Bereichen ins Land für Arbeit kommen, weil sie sich während den Lockdowns eine andere Arbeit gesucht haben. Jetzt fehlen im Tourismus vor allem Arbeitskräfte, die vor Corona zu uns gekommen sind – und diese Lücke kann ich nicht mit heimischen Personal auffüllen, weil es einfach nicht da ist.
Was sollte eine Bundesregierung da tun?
Das große Problem ist, dass „mehr Arbeiten“ sich nicht auszahlt. Wir haben so viele Steuer- und Sozialversicherungsbegünstigungen für Menschen mit niedrigem Gehalt, dass alle, die kalkulieren, merken: mein Stundensatz netto ist höher, wenn ich weniger als 30 oder gar 40 Stunden die Woche arbeite. Und Chefs, die ihre Mitarbeiter fragen „Würdest du mir statt 25 vielleicht 30 Stunden die Woche arbeiten?“, werden sie die Antwort bekommen: „Nein, weil das rentiert sich für mich nicht.“
Wir haben so eine steile Progression in der Besteuerung von Lohnarbeit, dass sich Mehrarbeit zu wenig auszahlt – und zwar schon bei Mittelverdienern. Wir besteuern in Österreich die Mittelschicht, als ob das alles Großverdiener wären. Das war vor 30 oder 40 Jahren noch nicht so, das muss sich wieder ändern. Da könnte die Regierung viel machen. Da spielt auch die mangelnde Kinderbetreuung in Österreich hinein: Wenn Eltern hier kein gutes Angebot haben, können sie nicht mehr arbeiten, auch wenn sie wollen würden.
Gerade Steuern auf Arbeit und Kinderbetreuungsangebot haben einen massiven Einfluss auf den Standort, die Probleme hier werden nur größer werden und der Attraktivität Österreichs als Standort schaden. Was muss getan werden?
Schauen wir nur, wo Österreich jetzt schon schlechter da steht als andere: Das ist die Abgabenbelastung auf Arbeit. Ungefähr ein Drittel der Lohnnebenkosten haben mit der Belegschaft selbst gar nichts zu tun, das kommt einfach dem Finanzministerium zu Gute. Auch auch bei jenen Kosten, die direkt die Arbeitnehmer:innen betreffen, sind die Quoten überdurchschnittlich hoch im internationalen Vergleich. Wir machen uns hier die internationale Konkurrenzfähigkeit kaputt. Da könnte man mit etwas mehr Sparsamkeit im System enorm viel bewirken und auch die Unternehmen entlasten, die dann auch höhere Löhne zahlen oder weitere Personen anstellen könnten.
Das ist einfach der wichtigste Punkt: Wir müssen die Abgaben senken, damit der Wirtschaftsmotor leichter brummt, davon profitieren wir alle. Verfahren dauern in Österreich auch viel zu lange in Österreich – alleine wie viele Behörden hier involviert sind! Es dauert, wenn es sehr schnell geht, ein Jahr, bis ein Betrieb eine Baubewilligung für eine Fabrikshalle bekommt. In der Schweiz kann in sechs Wochen gebaut werden. So können wir keine internationalen Betriebe ansiedeln. Und da haben wir noch gar nicht die überalterte Gewerbeordnung, die restriktiven Öffnungszeiten oder die Bürokratie erwähnt. Eine Bundesregierung, die was weiterbringen will, müsste sich all diese Bereiche ernsthaft anschauen.