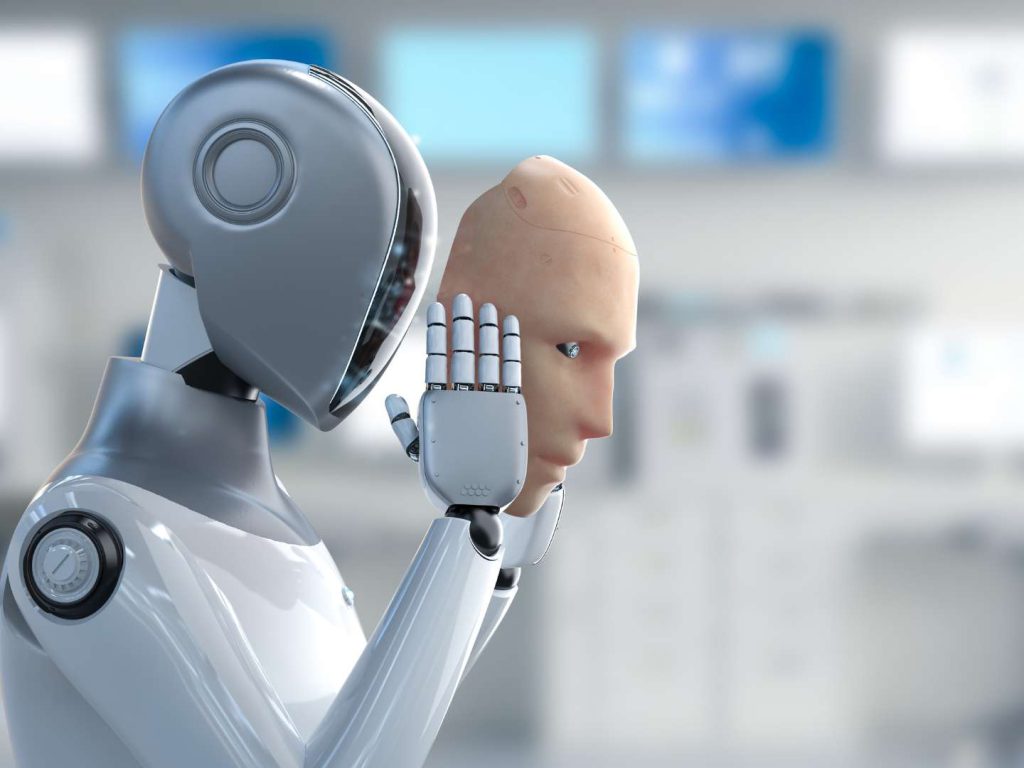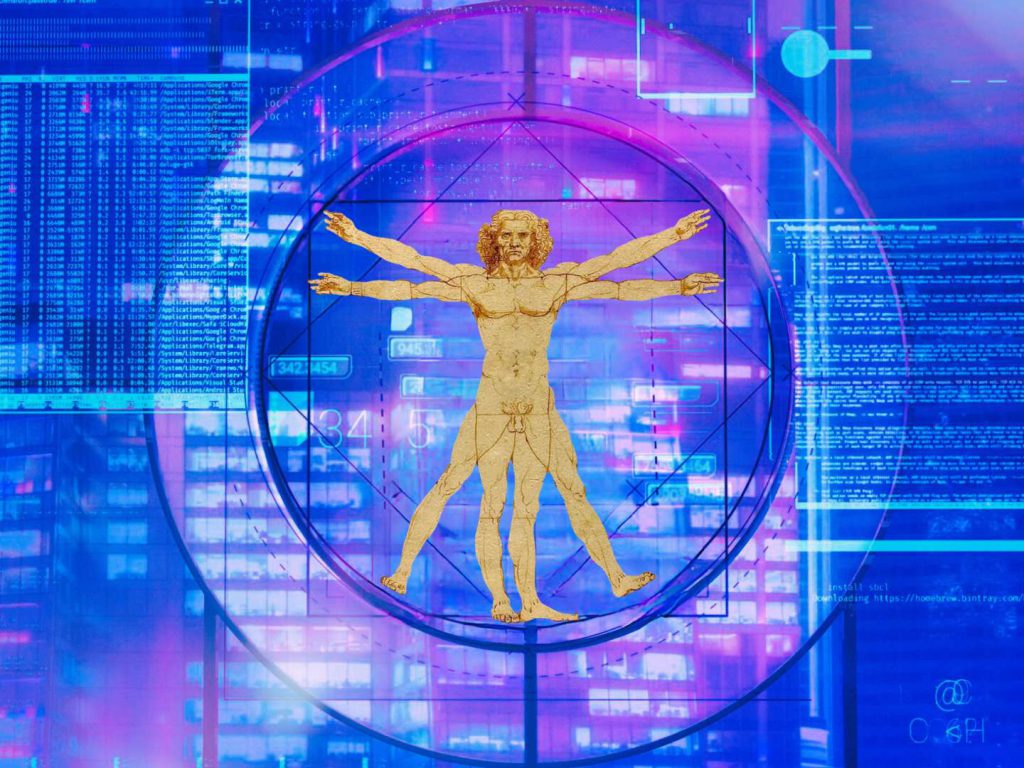Arbeitsbedingungen: Der Elefant im Patientenraum

Wer ein gutes Gesundheitssystem will, braucht gute Leute. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch eine der Arbeitsbedingungen. Trotzdem wird immer nur über Personalmangel gesprochen – und nicht über die Arbeitsumstände.
Die Debatte über den Arbeitskräftemangel ist in den letzten Jahren vielfältiger geworden: Fragen nach Jobzufriedenheit und verschiedenen Arbeitszeitmodellen beginnen langsam auch in der Gesundheitsbranche anzukommen. Im öffentlichen Bereich wird aber nur auf einen Faktor verwiesen: Geld. Wer zumindest ohne Probleme Miete, Essen, Kinder, Auto und halbwegs regelmäßig Urlaube bestreiten kann, beschwert sich aber meist nicht aus Gehaltsgründen über die Arbeit. Denn was diese Zufriedenheit maßgeblich steuert, sind Arbeitsbedingungen.
Bei den großen staatlichen Aufgaben – Bildung, Kinderbetreuung, Gesundheit und Sicherheit – werden diese nur selten diskutiert. Gerade bei Gesundheit liegt das wohl auch daran, dass niemand wirklich zuständig ist. Bund, Länder und Gemeinden sind alle für verschiedene Ebenen verantwortlich, die konkreten Arbeitsbedingungen müssten von den Arbeitgeber:innen geändert werden. Und das sind oft Bundesländer oder Gemeinden als Eigentümer von Krankenhäusern und Pflegeheimen.
Die Ausnahme sind niedergelassene Ärzt:innen, die fast alle selbstständig sind – damit endet die Diskussion meist wirklich beim Geld. In Krankenhäusern und Pflegeheimen gibt es dafür abertausende Mitarbeiter:innen verschiedenster Berufsrichtungen, für die Arbeitsbedingungen ein entscheidender Faktor sind.
Kein Fokus auf Arbeitsbedingungen
lm Nationalrat und in Landtagen werden Anträge zu Arbeitsbedingungen aber abgelehnt oder vertagt. Im Nationalrat handelte es sich dabei um einen Antrag, der in Folge des Ukraine-Kriegs mehr psychische Betreuung für Krankenhausangestellte ermöglichen sollte. Viele Vertriebene konnten kein Deutsch und mussten selbst für chronische Krankheiten zur Medikationseinstellung ins Krankenhaus. Andere hatten mit Kriegsverletzungen, Traumata oder komplizierten Krankheitsbildern zu kämpfen – und das, ohne sich verständigen zu können.
Für Mitarbeiter:innen im Gesundheits- und Sozialbereich ist es in solchen Fällen nicht immer einfach, sich emotional vom Schicksal der Patient:innen zu distanzieren. Gerade in den ersten Monaten des Kriegs war das eine enorme Herausforderung, viele konnten (direkt anschließend an die Belastungen der Pandemie) nicht souverän damit umgehen.
Weil das Gesundheitsministerium nicht zuständig ist, forderte der Antrag das Ministerium auf, mit den Ländern als Krankenhausbetreiber darüber zu sprechen. Immerhin wird dem Ministerium die Schuld für den Personalmangel gegeben, da könnte auch an Lösungen mitgearbeitet werden. Aber nicht nur im Ministerium will man sich nicht mit Arbeitsbedingungen auseinandersetzen – sondern auch in den Ländern werden solche Anträge zur Entlastung der Mitarbeiter:innen mit halbgaren Erklärungen abgelehnt. Beispielsweise in Vorarlberg, wo die Lösungsvorschläge „zu konkret“ sind.
Digitalisierung als Entlastung
Einer der Streitpunkte ist die Digitalisierung. Nachdem die Kompetenzen von Gesundheitsberufen so verschieden verteilt sind, brauchen fast alle Tätigkeiten eigene Anweisungen von Ärzt:innen an Pflegekräfte, von gehobenen Pflegekräften auf solche mit weniger Ausbildung.
Das alles bedeutet Papierarbeit. Anweisungen, Dokumentationen, Übergabeberichte – in denen immer wieder die gleichen Dinge vermerkt werden, was wann von wem mit welcher Intention gemacht wurde oder gemacht werden soll. In der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) landet das oft nicht. Kliniksoftware ist nämlich nur selten mit ELGA integriert, obwohl das Einspielen von Befunden gesetzlich vorgeschrieben ist. Es wird also im Spital dokumentiert, was gemacht wird, Röntgenbilder eingespielt, es werden Rezepte ausgestellt. In den ELGA-Akten der Patient:innen taucht das wegen des hohen Arbeitsaufwands zum Einspielen nicht immer auf. Patient:innen mussten deshalb extra vor Gericht ziehen, um ihre Patientendaten zu erhalten.
Dabei wäre eine bessere Nutzung von ELGA nicht nur für Patient:innen und Krankenhauspersonal eine Erleichterung, sondern könnte Mitarbeiter:innen in Pflegeheimen entlasten. Denn die Entlassungsbriefe von Ärzteschaft und Pflege im Krankenhaus müssten nicht erst mühsam angefordert werden, sondern wären direkt verfügbar. Pflegebriefe anfordern, Rezepte einlösen, Anträge auf Windeln bei der Kasse stellen – das machen qualifizierte Pflegekräfte nämlich, während sie ihre Arbeitszeit eigentlich mit den Menschen verbringen sollten.

Symbolbild, produziert mit Midjourney AI
In Krankenhäusern verwenden Ärzt:innen oft die ruhigeren Stunden von Nachtdiensten, um Papierberge abzuarbeiten, Befunde zu diktieren oder Entlassungsbriefe für Patient:innen nachzureichen. Wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, müssen diese in der Früh nach 12-, oder noch schlimmer, 25-Stunden-Diensten noch fertiggeschrieben werden.
Gesundheit und Sicherheit
Neben dem bürokratischen Aufwand ist die Arbeit im Gesundheitswesen auch körperlich anstrengend. Unterschiede zwischen Operationen, Physiotherapie und den verschiedenen Formen der Pflege gibt es natürlich. Gemeinsam ist allen Bereichen, dass Patient:innen gehoben, gedreht und umgebettet werden, was bei täglich mehrfacher Wiederholung auf die Bandscheiben geht. Körperliche Prävention spielt in der Ausbildung aber nur eine untergeordnete Rolle, oft wird auf Betriebsärzte für Nachschulungen verwiesen. In welchen Krankenhäusern Prävention gelebt wird, oder ob es sich für Mitarbeiter:innen ausgeht, diese zu nutzen, weiß niemand.
Dabei ist der Fokus auf den eigenen Körper und dessen Schutz nicht zu vernachlässigen. Besonders weil seit Jahren über zunehmende Gewalt gegenüber Krankenhauspersonal berichtet wird. Wartezeiten, überzogene Erwartungshaltungen und die Pandemie scheinen die Gewaltbereitschaft von Patient:innen zu erhöhen. In manchen Krankenhäusern wurden Securitys für Ambulanzen angestellt, in anderen wurden Selbstverteidigungskurse für Personal angeboten.
Dass es Schutzmaßnahmen gibt, ist gut – gesellschaftlich betrachtet ist es aber fatal, wenn Pflegekräfte und Ärzt:innen in ihrem Arbeitsalltag regelmäßig bedroht werden, Angst vor körperlicher Gewalt haben und Polizeieinsätze keine Seltenheit sind. Bis Securities direkt vor Ort sind, ist das Personal auf sich allein gestellt. Wie in Altersheimen, wenn Demenzpatient:innenen aggressiv werden. Auch dort gibt es Fachausbildungen und einen Aktionsplan; ob und welche zusätzlichen Schulungen Mitarbeiter erhalten, um ihren Körper und ihre Psyche vor den Folgen ihrer Arbeit zu schützen, weiß wieder niemand.
Dass aktuelle Streiks auch Burn-out und Erschöpfung der Mitarbeiter:innen thematisieren, kann für Fortschritte sorgen. Immerhin geschehen 40 Prozent der gesundheitsbedingten Frühpensionen aus psychischen Gründen, und der Personalmangel kann bei attraktiven Arbeitsbedingungen leichter gelöst werden. Österreichs Krankenhäuser und Altersheime müssen sich nicht nur die Frage stellen, wie sie die bestmögliche Versorgung für Patient:innen anbieten können, sondern auch, wie sie attraktive Arbeitgeber werden können. Mit finanziellen Anreizen, um Mitarbeiter:innen aus einem Bundesland in ein anderes zu locken, wird das langfristig nicht klappen. Stattdessen müssen Strukturen modernisiert werden, die verschiedenen Pflege-, Ärzte- und Verwaltungsdirektionen müssen besser zusammenarbeiten.
Andernfalls könnte der Personalmangel andere Reformen vorantreiben: mehr ambulante Operationen, weil keiner in der Nacht betreuen kann. Mehr Tagesbetreuung für Senior:innen, die gerade noch alleine wohnen können. Mehr zusätzliche Kinderbetreuungseinrichtungen in Unternehmen. Genau weiß man es nie. Für alle, die im Gesundheitsbereich arbeiten, kann man nur hoffen, dass das Gedankenbild sich bald ändert. Und für das Gesundheitssystem, dass der Personalmangel andere notwendige Reformen antreiben wird.