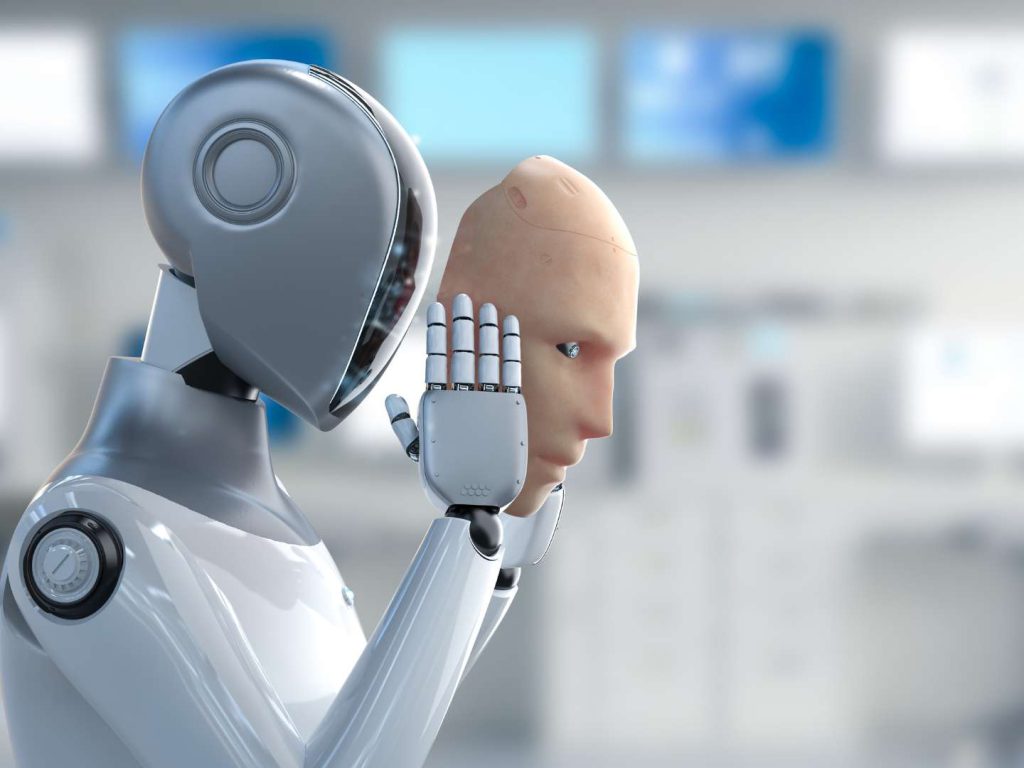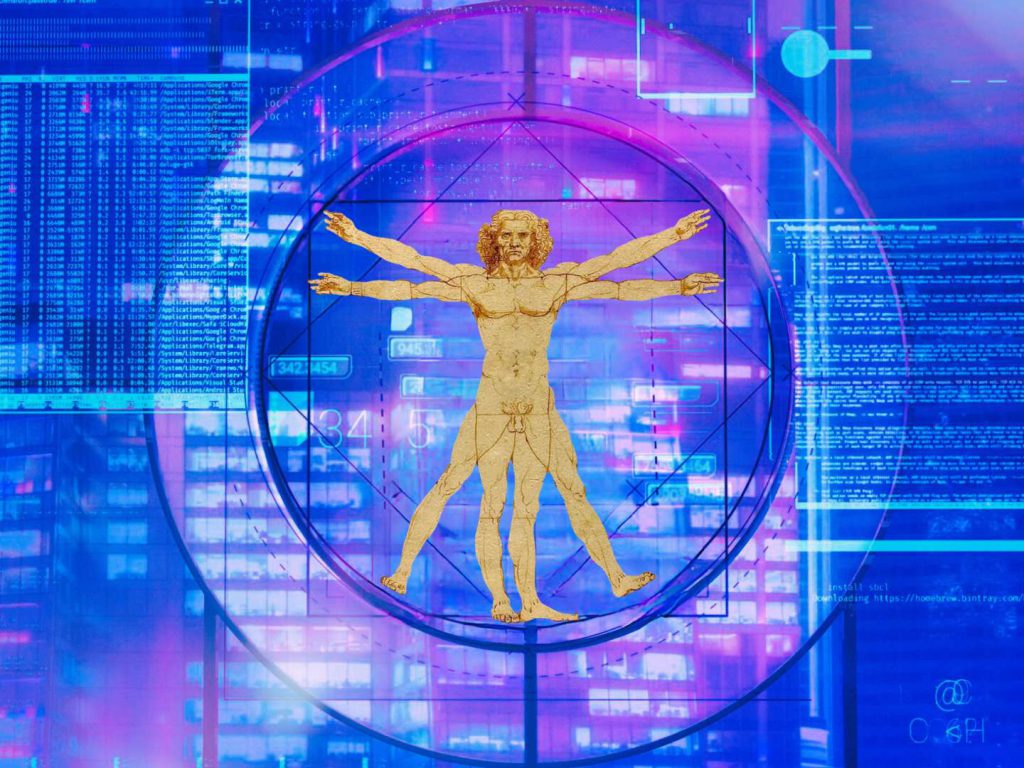Das Märchen vom Ärztemangel

Seit Jahren wird von einem Zusammenbruch des Gesundheitssystems gesprochen, seit Jahren bleibt die Grundthese gleich: Es gibt zu wenig Ärzt:innen. Wer schon einmal mit einem Arzt über 50 gesprochen hat, bekommt deshalb das Gefühl, dass Österreich direkt von einer Ärzt:innenschwemme Anfang der 90er in den Status eines Entwicklungslandes gefallen ist, in dem sich maximal ein:e Ärzt:in pro Bezirk befindet.
Entgegen der verbreiteten Annahme des Ärzt:innenmangels (wie hier, hier oder hier), hat Österreich im OECD-Schnitt die meisten Ärzt:innen – nämlich 5,5 pro 1.000 Einwohner. Trotzdem stehen Ärzt:innen mittlerweile sogar auf der Mangelberufsliste des Arbeitsministeriums. Wie kann es zu so konträren Auslegungen einer Zahl kommen?
Ärztemangel? Welcher Ärztemangel?
Natürlich gibt es verschiedene Statistiken zur sogenannten Medizinerdichte. Laut Ärztekammer wurden Ende 2022 47.722 Ärzt:innen gemeldet, das liegt nahe am OECD-Schnitt. Es gibt also genug Ärzt:innen – und sogar mehr als anderswo. Warum liest man dann regelmäßig vom Ärztemangel? Und wohin verschwinden all die Mediziner:innen?
In solchen Fällen handelt es sich um strukturelle Probleme. Denn Ärzt:innen gibt es ja, sie sind nur entweder nicht dort, wo Menschen sie brauchen, oder sie arbeiten an diesen Stellen nicht (effizient) genug – das ist keine Wertung über Arbeitszeitmodelle, sondern eine Feststellung anhand von Angebot und Nachfrage.
Der erste Gradmesser für einen Mangel sind die Krankenkassenpraxen, dort sollten Patient:innen immer zuerst aufschlagen. Im Jänner beklagte die Ärztekammer medial noch 300 freie Stellen, die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) sprach dagegen von 171 Stellen, also knapp mehr als der Hälfte. Von Rundungsfehlern keine Rede, zu groß ist die Differenz.
Kassenstellen sind unattraktiv
171 fehlende Kassenärzt:innenstellen klingen dramatisch. Dabei darf aber nicht vergessen werden: Oft variiert es sehr stark, wo und wie lange diese frei sind.
In St. Pölten z.B. wurde eine Kassenstelle für eine:n Kinderärzt:in während der Pandemie über 70-mal ausgeschrieben und erst nach zwei Jahren besetzt. Möglicherweise weil der Kassenvertrag für Kinderärzt:innen als ein unattraktiver Vertrag gilt und man in der Pädiatrie weniger verdient als in anderen Fachrichtungen. Oder weil während einer Pandemie noch mehr Kinder und ihren panischen Eltern zu erwarten sind, andere könnten auch selbst Kinder haben, und die Kinderbetreuung in Niederösterreich ist mit Vollzeitarbeit nur schwer zu vereinbaren. Bedenkt man all das: Würden Sie die Kassenstelle annehmen? Oder lieber am Vormittag bei den eigenen Kindern bleiben, am Nachmittag einige Stunden eine Wahlordination betreiben und daran gut verdienen?
Auch in St. Johann in Tirol wurde sechs Jahre lang ein:e Kinderärzt:in gesucht. Falls Ihnen die Gemeinsamkeit der Fachrichtung auffällt: Ja, es fehlen immer die Gleichen. Allgemeinmedizin, Pädiatrie, Gynäkologie, auch Dermatologie sind Fachrichtungen, in denen man oft von einem Mangel an Kassenverträgen und einem Übermaß an Wahlärzt:innen spricht. Aber wer einen dieser Ärzt:innen benötigt, ist notfalls bereit zu zahlen. Ein Besuch bei eine:r Gynäkolog:in kostet mittlerweile zwischen 120 und 160 Euro. Erstattet bekommen Patient:innen 80 Prozent der Kassenkosten, das sind um die 50 Euro. Als Kassenärzt:in bekommt man also knapp 70 Euro pro Patient:in, ohne Kassenvertrag kann man mit einem Patientenkontakt also so viel wie mit Kasse mit zweien verdienen – und ist nicht zu vorgegebenen Öffnungszeiten verpflichtet, sondern kann an einem oder zwei Tagen die Woche einfach gar nicht arbeiten.
Bei Allgemeinärzt:innen sind aber immer noch mehr „im System“, als man aufgrund mancher Artikel denken könnte. Von rund 11.400 Allgemeinärzt:innen sind nur 21 Prozent gänzlich ohne Vertrag, bei den Fachärzt:innen liegt der Anteil knapp bei 30 Prozent.
Wie viele Kassenverträge gibt es eigentlich?
Wichtig ist, dass die Zahl der Kassenverträge nicht unbedingt etwas aussagt. Sie mögen ein Richtwert sein, doch im April sollen 71 Kassenstellen alleine in Oberösterreich frei gewesen sein. Gemessen an den Berichten vom Jänner wäre also fast ein Drittel der freien Verträge in Oberösterreich gewesen, was ein bisschen unwahrscheinlich ist. Eine mögliche Erklärung sind die verschiedenen Zählweisen, ÖGK und Ärztekammer beschuldigen sich öffentlich oft gegenseitig, dass die Zahlen nicht stimmen. Gruppenpraxen, Anstellungen im ärztlichen Bereich, Ordinationen, die Kassenverträge haben und an einzelnen Tagen als Wahlordinationen geführt werden, die Verträge von Primärversorgungszentren – sie alle führen zu verschiedenen Statistiken.
Grundsätzlich werden freie Kassenstellen auf den Portalen der Ärztekammern ausgeschrieben, theoretisch müssten die Zahlen von Kasse und Kammer also übereinstimmen. Zumindest zwischen den Bundesländern gibt es aber enorme Unterschiede:
Das Grundproblem: Mangelnde Steuerung
Auch das könnte aufgrund der verschiedenen Kassenverträge sein. Die Gebietskrankenkassen wurden zwar zusammengefasst, doch die jeweiligen Leistungskataloge haben Kammer und Kasse noch nicht vereinheitlicht. Denn obwohl die Unterschiede, wo für welche Leistung wie viel bezahlt wird und wie viel die Patient:innen erstattet bekommen, einer der Gründe für die Zusammenlegung waren, ist die Vereinheitlichung jetzt eine enorme und zeitintensive Aufgabe.
Schließlich will keine Kammer und keine Fachrichtung auf bisherige Einnahmen verzichten. Die unterschiedlichen Verträge könnten auch ein Grund sein, warum bestimmte Fachrichtungen oder Bundesländer attraktiver für die Kassentätigkeit waren als andere. Potenziell sogar ein Grund für die verschiedenen Fachverteilungen, also wie viele Ärzt:innen es in welcher Fachrichtung gibt. Beispielsweise arbeiten die meisten Mediziner:innen in der Allgemeinmedizin, aber nur 10 Prozent der Ärzt:innen sind in der Pädiatrie. Dabei machen Kinder und Jugendliche 19,3 Prozent der Bevölkerung aus – das Verhältnis ist also schief.
Wie dieses Verhältnis repariert werden kann, ist aber nicht klar. Bisher gab es nämlich keinerlei Steuerung, wie viele Ärzt:innen in welchen Fächern benötigt oder ausgebildet werden. Das bietet für Medizinstudent:innen zwar alle Entscheidungsfreiheiten – als Staat braucht man sich anschließend aber auch nicht wundern, warum es in bestimmten Fachrichtungen nicht genug Personal gibt.
Krankenhäuser als Tonangeber
Den größten Steuerungseffekt über die Fachrichtungen haben die Bundesländer als Krankenhausbetreiber. Sie legen fest, wie viele Ausbildungsstellen es für welche Fachrichtung gibt. Auch hier sind je nach Krankenhaus verschiedene Stellen interessanter, in sehr kleinen Krankenhäusern braucht es beispielsweise keine Radioonkolog:innen, schließlich werden schwerkranke Krebspatient:innen in größere Krankenhäuser mit den passenden Geräten weitergeschickt. Es können also nur in großen Krebszentren Radioonkolog:innen ausgebildet werden. Wie viele Ausbildungsstellen es gab, ist unklar, aber die Radioonkologie war jahrelang ein Mangelfach. Mittlerweile gibt es in Österreich wieder 173 Ärzt:innen mit dieser Fachspezialisierung, in anderen Bereichen sieht es weniger rosig aus. So gibt es von den ebenso mangelnden Gerichtsmediziner:innen nur 27, davon sind 18 älter als 50 Jahre. Im Sinne der Kriminalaufdeckung, des Opferschutzes bei Gewalttaten und auch der Ausbildungssicherung müssen also rasch Medizinabsolvent:innen in dieses Fach gelockt werden.
Die Frage der Altersverteilung wird auch gerne als Argument für den Mangel und dessen akute Bedrohung genutzt. Ärzt:innen mit eigener Ordination sind selbstständig, Pensionsantrittsalter gibt es deshalb nicht, und Kassenverträge darf man bis 70 behalten. Aufgrund der Diskussionen über Personalengpässe fordern Seniorenbund und Ärztekammer sogar eine Aufhebung dieser Grenze. Immerhin wird die Altersstruktur als Argument verwendet, warum der Mangel sich weiter verschärfen wird. In der jetzigen Altersstruktur der Ärzteschaft sieht man aber mehrere Dinge. Erstens: Richtige Pensionierungswellen gibt es nicht; und zweitens: Der größte Teil ist zwischen 30 und 40 Jahre alt. Logischerweise, denn wer Medizin studiert, beginnt nur selten vor 30 mit der Arbeit, bei sechs Jahren Studium und fünf Jahren Facharztausbildung geht es sich anders nur für wenige aus. Der Nachwuchs ist also größer, als durch die Statistik suggeriert wird.
Immerhin schlossen seit 2016 jährlich zwischen 1.500 und 1.700 Personen ein Medizinstudium ab, das entspricht ungefähr der Summe der berufstätigen Mediziner:innen über 70 Jahren. Könnten all diese Personen in Krankenhäuser und Kassenverträge gebracht werden, wäre die Frage der „Pensionierungswelle“ obsolet. Aber wie beliebt Ausbildungen in verschiedenen Fachrichtungen sind, hängt mit dem Arbeitsalltag und den Aussichten auf diesen zusammen. Denn die Ausbildung passiert im Krankenhaus, der Arbeitsalltag aber nicht unbedingt. Wenn der Staat (wie bei Amts- oder Schulärzt:innen oder in der Gerichtsmedizin) oder Universitäten (wie häufig bei Public Health oder bestimmten Forschungsrichtungen) der einzige Arbeitgeber ist, gibt es einen noch größeren Mangel an Personal – denn keiner setzt Anreize, in diese Fachrichtung zu gehen. Die Ausbildung in einem Krankenhaus bringt dem Krankenhaus wenig, und die Ärztekammer ist nur eine bedingt starke Vertretung für diese Fachgruppen – immerhin gibt es wenige selbstständig Ärzt:innen, die Fürsprache brauchen, und der Verhandlungspartner ist schwieriger zu greifen als ein Krankenhausbetreiber oder früher eine Landeskrankenkasse. Also hat sich teilweise über Jahrzehnte in Fachrichtungen wie Public Health, Anatomie oder Arbeitsmedizin ein enormer Mangel aufgebaut – was dafür sorgt, dass es in Österreich jeweils keine 50 Personen mit diesen Fachausbildungen gibt.
Lösungsansätze für den gefühlten Ärztemangel
Die Mängel werden mittlerweile erkannt, über die Verteilung wird noch immer nicht ausreichend diskutiert. Ein Hebel könnte der Finanzausgleich sein – über diesen verhandelt der Bund mit den Bundesländern über die Geldflüsse im Gesundheitswesen. Da Spitäler Ländersache sind, könnte der Bund Anreize setzen, für welche Bereiche es mehr Ausbildungsplätze braucht, oder vorgeben, wie man diese attraktiver gestalten soll, z.B. über den Anteil der Ausbildungszeiten in Lehrpraxen oder unterschiedliche Dienstzeiten. immerhin gibt es auf einer Augenstation wohl weniger Bedarf für Nachtdienste als in der Chirurgie, und auch Augenärzt:innen scheinen in manchen Regionen zu fehlen.
Wichtig wäre eine Ausbildung, die praktisch umsetzbar ist. Aktuelle Entwürfe für den Facharzt in Allgemeinmedizin werden von der Ärzteschaft eher kritisch gesehen, und auch die kürzlich reformierte Ausbildung für den notärztlichen Bereich kann de facto nicht umgesetzt werden. Zu hoch ist der theoretische Anspruch an die gelernten Inhalte, zu gering die Möglichkeit für angehende Mediziner:innen, diese Vorgaben im Arbeitsalltag zu erreichen.
Danach folgt die Frage der Arbeitsgestaltung. Als Lösung werden immer wieder Primärversorgungszentren und Gruppenpraxen genannt – in diesen müssten weniger Ärzt:innen selbst unternehmerisch tätig werden, dadurch könnten sie mehr Zeit mit Medizin verbringen. Alternativ bieten die Sozialversicherungen seit einiger Zeit sogenannte Susi-Sorglos-Pakete an, Anfang 2023 wurde auch begonnen, Ärzt:innen bei der ÖGK selbst anzustellen. Das wirft zwar gänzlich andere Diskussionen auf, wie die ärztliche Versorgung zur Verfügung gestellt werden soll – den meisten Patient:innen wird es aber egal sein.
Wichtig ist nur, dass Mediziner:innen nicht mehr Teilzeit in Wahlarzt-Ordinationen sitzen, sondern auch für die Beitragszahler:innen Leistungen erbringen. Wenn das geschafft wird, wird wohl auch endlich den Zahlen geglaubt – und der Mythos vom Ärzt:innenmangel verschwindet. Bis dahin wird es aber wohl noch länger dauern.