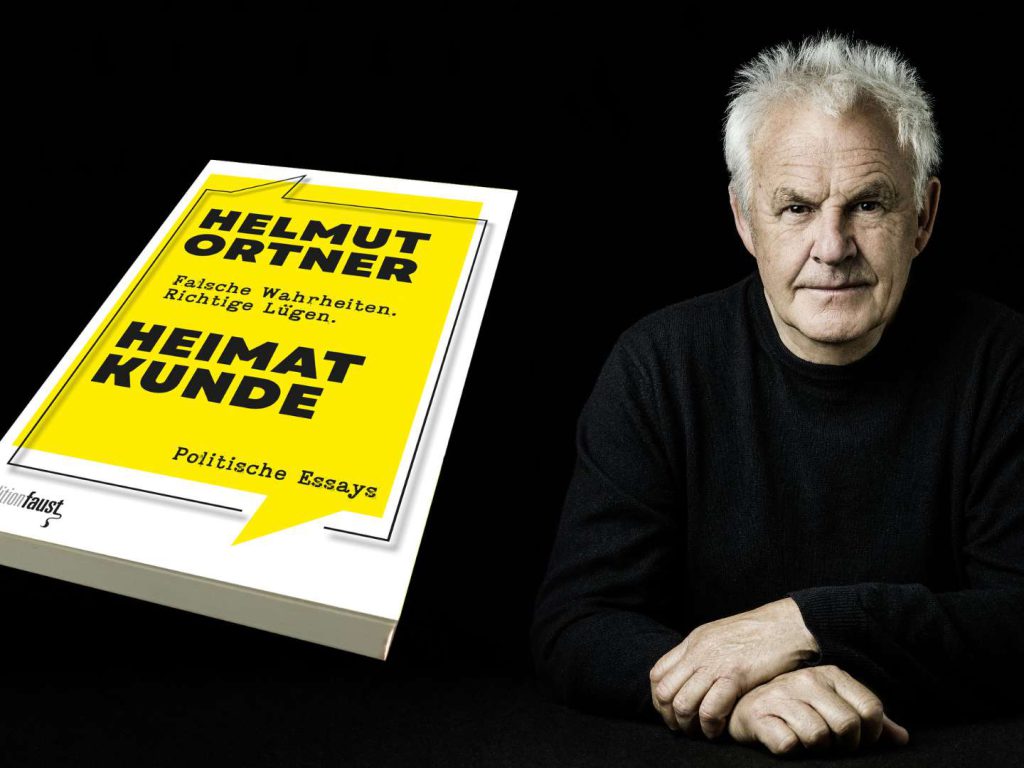Walter Feichtinger: „Wir haben keine Kultur der strategischen Kommunikation“

Der frühere Brigadier Walter Feichtinger gibt im Materie-Interview ausführliche Einblicke in die strategischen Herausforderungen der Verteidigungspolitik.
Assistenzeinsatz an der Grenze, Hilfe im Katastrophenfall, Sparkurs-Debatte in Wien: Das österreichische Bundesheer ist oft Thema, aber selten, weil es um die konkreten Aufgaben der Landesverteidigung geht. Genau darüber wollen wir aber sprechen – denn angesichts des Kriegs in Europa liegt die Frage nahe, ob Österreichs Sicherheitsstrategie noch aktuell ist.
Für alle, die das noch nicht wussten: Ein Brigadier ist ein Oberst, der seit drei Jahren eine Brigade kommandiert. Für unser Interview bedeutet das: Walter Feichtinger kennt das Militär in leitender Rolle von innen. Wir wollen von ihm wissen, welchen strategischen Fragen sich die Politik zu widmen hat und was das Bundesheer braucht, wenn die Diskussion um „mehr Geld“ wieder laut wird. Aber wir sprechen auch darüber, welche Probleme man nicht nur mit Geld lösen kann.
Herr Feichtinger, fangen wir vielleicht mit der naivsten aller Fragen an: Wie geht es dem Bundesheer gerade?
Dem Bundesheer geht es zunehmend besser. Einerseits ist die Aufmerksamkeit in der Politik gestiegen und damit auch das Budget. Aber andererseits haben auch das Interesse der Öffentlichkeit und die Akzeptanz in der Bevölkerung zugenommen. Das sind gute Voraussetzungen für eine Weiterentwicklung des Bundesheers. Das ist dringend notwendig, weil es davor jahrzehntelang vernachlässigt wurde. Wir sehen ja, dass das Bundesheer erstaunlicherweise noch funktioniert, aber dass es an allen Ecken und Enden mangelt.
Sie sagen „jahrzehntelang vernachlässigt“ – warum wurde denn beim Bundesheer so viel gespart?
Schon nach der Auflösung der Sowjetunion 1991 ist in Europa eine Friedenseuphorie ausgebrochen. Wenn man von den innerjugoslawischen Kriegen absieht, haben wir jetzt 30 Jahre Frieden in Europa – eine unglaubliche Epoche des Friedens. Aber dadurch haben wir vieles ignoriert: Es gibt jährlich in etwa 35 bis 40 bewaffnete Konflikte, und das hat man bei uns nicht zur Kenntnis genommen. Je weiter weg, desto weniger fühlt man sich betroffen und gefährdet.
Stichwort „Das geht uns ja gar nichts an“.
Österreich und Europa waren einfach nicht in der Lage, geostrategisch zu denken und zu erkennen, dass erstens auch weit entfernte Konflikte Auswirkungen auf Europa haben werden, und dass zweitens autoritäre Staaten sehr wohl immer noch das Militär als Instrument der Politik sehen. Das haben wir ignoriert – deswegen wurden in Europa die „Friedensdividende“ großgeschrieben und die Verteidigungsbudgets halbiert.
Es kam aber auch eine strategische Wende: dass man nämlich nicht mehr die Verteidigung Europas als Priorität gesehen hat, sondern das internationale Krisenmanagement, Stichwort 9/11 und darauf folgende Einsätze im Irak und in Afghanistan. Wir sind dem Trugschluss aufgesessen, dass man Demokratie exportieren kann und dass wir unser Lebensmodell auf Regionen übertragen können, die sich in ganz anderen Rahmenbedingungen befinden. Dadurch ist die Verteidigung Europas aus dem Blickpunkt gerückt.
Und jetzt müssen wir bitter zur Kenntnis nehmen, dass wir einen Nachbarn haben, der die Welt anders sieht als wir. Der bereit ist, auch das Militär für seine politischen Zwecke einzusetzen, gegen die Charta der Vereinten Nationen zu verstoßen, die Souveränität eines Landes zu ignorieren und militärische Gewalt anzuwenden.
Wie äußert sich dieses Ende der Friedensdividende?
Es gibt bei den Verteidigungsbudgets schon seit 2014 – also seit dem Jahr der Annexion der Krim – eine Vorgabe innerhalb der NATO, dass innerhalb von zehn Jahren – also bis nächstes Jahr – die Budgets auf mindestens 2 Prozent ansteigen sollten. Das haben einige Staaten eine Zeit lang vernachlässigt, mittlerweile aber nicht mehr. Polen vertritt sogar die Meinung, dass 2 Prozent die Untergrenze sein sollten, und plant sein Verteidigungsbudget mit 4 Prozent. Die Zeit der Friedensdividende ist also vorbei – die Zeit der Aufrüstung wird kommen, und die konventionellen Verteidigungsmöglichkeiten stehen wieder im Mittelpunkt.
Innerhalb der EU gibt es diese Vorgabe nicht – das heißt, Österreich als Nicht-NATO-Land kann selbst entscheiden, wie es sein Verteidigungsbudget gestaltet. Wir haben jetzt zwar einen Plan, der deutlich nach oben zeigt, aber immer noch deutlich unter den NATO-Vorgaben liegt. Das Bundesheer müsste in hohem Maße komplett neu aufgebaut werden.

Wofür konkret braucht es z.B. mehr Geld?
Wir haben zwar noch einigermaßen taugliches Gerät, das muss aber generalüberholt werden. Die Panzertruppe muss zum Teil aufgestockt, die Fliegertruppe modernisiert werden. Es braucht neue Systeme, die die Bedrohungen von heute bewältigen können, z.B. Raketenabwehr oder im Cyber-Bereich. Österreich hat also die Aufgabe, das alles eigenständig zu planen und auf dem internationalen Markt zu besorgen, wo es ja einen starken Wettbewerb gibt, sollte aber gleichzeitig nicht die europäische Dimension vergessen.
Dass das Bundesheer mehr Geld bekommen soll, da sind sich mittlerweile so gut wie alle einig. Aber gibt es auch Probleme, die nicht mit Geld gelöst werden können?
Zwei wichtige Punkte. Erstens: Wir haben momentan ein Wehrsystem, das junge Menschen zum Bundesheer bringt, die man danach nicht mehr als Soldaten einsetzen kann, weil es die Übungspflicht nicht mehr gibt. Deren Abschaffung war ein ganz großer Fehler. Wenn wir ernsthaft daran denken, wieder ein Bundesheer für funktionierende Landesverteidigung zu haben, müssen wir diese Fehler beheben. Da braucht es eine gesetzliche Absicherung – denn es gibt zwar Freiwillige, aber die müssen ja auch von der Wirtschaft freigestellt werden. Wer einen Dienst für Österreich leistet, darf keinen Nachteil dadurch haben.
Und zweitens: Wir sollten auch nicht den Fehler machen, Verteidigung und Sicherheit nur beim Bundesheer zu verorten. Da beginnen wir nicht bei null, wir hatten ja in den 80er Jahren den Begriff „umfassende Landesverteidigung“ – dieses gesamtstaatliche Denken braucht es wieder. Das gehört natürlich modernisiert und an die heutige Lage angepasst, was die Bedrohungslage und die internationale Dimension angeht, die damals noch kein Thema waren.
Wenn Sie „gesamtstaatlich“ sagen, wen meinen Sie da noch, außer das Bundesheer? Polizei und Geheimdienste?
Das beginnt bei der geistigen Landesverteidigung. Wenn wir uns die jüngsten Umfragen anschauen, sind angeblich nur noch 20 Prozent der Jungen bereit, Österreich zu verteidigen. Da läuten bei mir die Alarmglocken. Sind uns unsere Demokratie und unser Wohlstand nichts mehr wert? Können wir nicht vermitteln, dass diese Werte gefährdet sind oder dass sie verteidigt werden müssen? Demokratie ist ja keine Selbstverständlichkeit, für sie muss man täglich eintreten.
Aber mit „umfassend“ meine ich auch, dass wir alle Bereiche mitdenken müssen. Früher gab es die wirtschaftliche, geistige, militärische und zivile Landesverteidigung – das müssen wir heute noch breiter sehen, weil wir auch den Cyberbereich haben, der umfassend zu koordinieren ist. Für mich ist daher auch vollkommen klar, dass wir wieder eine zentrale Stelle brauchen, die sich diese Aufgabe umhängt. Und die kann nicht im Innenministerium sein, sondern ist als gesamtstaatliche Aufgabe im Bundeskanzleramt anzusiedeln. Das hat es früher gegeben.
Sie haben angesprochen: Entweder man weiß nicht, dass die Demokratie in Gefahr ist, oder man weiß nicht, dass man sie verteidigen kann. Ich würde beides bejahen. Ich bin z.B. 29, und mir kommt nicht vor, dass in meinem Jahrgang viele daran glauben, dass das Bundesheer etwas verteidigen könnte. Gerade jüngere Menschen kennen das Heer ja hauptsächlich im Zusammenhang mit Sparkursen. Kommen da genug Menschen auf die Idee, dass sie damit etwas verteidigen könnten?
Tatsächlich, in der öffentlichen Wahrnehmung ist das Bundesheer zu einem Katastrophenhilfeinstrument „verkommen“. Das kann aber nicht die Kernaufgabe sein – das Bundesheer ist kein technisches Hilfswerk. Wir hatten z.B. die Situation, dass man Soldaten nicht mehr mit Waffen auf Postern abbilden durfte, sondern nur noch mit Schlammschaufeln und Schlauchbooten. Das nagt natürlich am Selbstverständnis des Bundesheers. Daher muss das Militärische wieder im Vordergrund stehen. Diese grundsätzliche Ausrichtung hat das Bundesheer wieder gefunden, und wenn es mehr Geld dafür gibt, sollten auch die Leistungsfähigkeit und der Leistungswille besser werden.
Und der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben: Vielleicht wissen auch viele nicht, dass Demokratie und Wohlstand bedroht sind. Es gibt z.B. viele Menschen, die das Vertrauen in die Demokratie verloren haben und die sagen „Das funktioniert nicht“. Wenn dann noch Desinformation dazukommt, haben sogar viele davon eine gute Meinung von Autokraten wie Putin – gegen den sie unsere Demokratie mit all ihren Fehlern dann nicht verteidigen würden. Ist das nicht auch eine Gefahr für die geistige Landesverteidigung?
Absolut, das ist eine der größten Herausforderungen schlechthin: der gesamten Gesellschaft, vor allem aber auch der Jugend klarzumachen, was Österreich ausmacht. Was ermöglicht unseren Lebensstil, was stellt ihn sicher, und was passiert, wenn das nicht mehr garantiert ist? Wo würden Sie lieber leben – in Moskau oder in Wien? Neue Möglichkeiten zur Subversion, zur Unterwanderung mit Fake News und Halbwahrheiten sind etwas, worauf man die Gesellschaft einstellen muss, damit sie selbst einigermaßen in der Lage ist zu beurteilen, was Sache ist und was nicht.
Passiert das? Mein Eindruck ist, dass die Rechten mit Fake News angefangen haben, während unsere Institutionen noch immer mit dem Thema „Informationen auf Social Media“ kämpfen.
Das ist eine große Herausforderung in Österreich, weil wir generell ein bisschen träge sind. Und es ist schwer, Menschen aus ihrer Gemütlichkeit abzuholen. Natürlich ist es ungemütlich, all diese neuen Situationen und Möglichkeiten zur Kenntnis zu nehmen und Konsequenzen zu ziehen. Aber es ist zwingend erforderlich. Es ist leicht, Halbwahrheiten zu geben und alles negativ darzustellen – aber es ist unglaublich wichtig, auch die positive Seite zu sehen und zu sagen „Was macht uns aus? Was würden wir verlieren, wenn wir das nicht mehr hätten?“. Die Schlechtmacher haben leider immer die besseren Schlagzeilen.
Wenn jetzt ein Teil der Gesellschaft die Frage stellt, ob es das Bundesheer überhaupt braucht, und ein anderer sagt, Wladimir Putin ist eh nicht so schlimm: Wie sollte man damit in einer österreichischen Sicherheitsstrategie umgehen?
Das sehe ich nicht ganz so drastisch. Ich glaube nicht, dass die Hälfte der Gesellschaft auf der Seite Putins steht. Aber man muss sich mit den Realitäten auseinandersetzen und eine fassbare Botschaft vermitteln. Das ist es, was mir am meisten fehlt: Wir haben keine Kultur der strategischen Kommunikation. Wir schaffen es nicht, Sachen einfach zu fassen und in drei Aussagen zu formulieren, die den Leuten nahegehen, die sie abholen, die sie verstehen. Auch auf EU-Ebene wird wahnsinnig viel Gutes gemacht – man bringt es kommunikativ aber nicht rüber. Da müssen wir besser werden.
Das sind dann diese technokratischen Begriffe: klingt gscheit, versteht keiner.
Ich habe aufgeschrien, als ich von der „Friedensfazilität der EU“ gehört habe. Eine unglaublich wichtige Sache – aber mit dem Begriff verjage ich die Leute, statt sie abzuholen. Wir haben unglaublich gute Leute in der Werbebranche, in der Kommunikation. Warum holt man die nicht zusammen und sagt dann „Formuliert das neu, damit es rüberkommt?“.
Wenn wir uns jetzt also den Auftrag geben würden, eine neue Sicherheitsdoktrin zu schreiben: Was müsste denn drinstehen?
Das Wichtigste an einer neuen Sicherheitsdoktrin wäre der Rahmen: die Bedrohungslage und wie man mit ihr umgeht. Wir müssten unsere Ziele definieren: Sicher zu sein, unseren Wohlstand zu erhalten, die Demokratie zu sichern und ein verlässlicher Partner in Europa zu sein, um von diesen Errungenschaften zu profitieren. Was bedroht diese Zielvorstellungen? Autoritäre Systeme wie Russland, aber auch Elemente im eigenen Land, die das unterminieren. Das müsste man mal niederschreiben – das steht in der Sicherheitsstrategie von 2013 nämlich sicher nicht.
Schon die Obama-Administration hat sehr früh das Klima als Sicherheitsthema erkannt. Haben wir das aufgrund der Weltlage gerade weniger auf dem Schirm?
Wir haben momentan akute Gefahren wie Russland, aber eine Ebene darüber globale Herausforderungen. Und die größte davon ist sicher der Klimawandel mit all seinen Folgen, damit haben wir uns an der Landesverteidigungsakademie schon 2010 auseinandergesetzt. Aber wir haben auch die Bevölkerungsentwicklung zu beachten. Die Bevölkerung nimmt gerade in Afrika und Asien enorm zu, während sie anderswo abnimmt. Das führt wiederum zu mehr Migrationsdruck. Auf all diese Situationen müssen wir Antworten finden und sie im Auge behalten. Wir dürfen nicht wie das Karnickel auf die Schlange schauen, weil Russland vor der Tür steht – es gibt genug zu tun, wir sollten uns aber nicht zu Tode fürchten.
WALTER FEICHTINGER ist ehemaliger Brigadier des Österreichischen Bundesheers und Präsident des Centers für Strategische Analysen, einer unabhängigen Plattform für sicherheitspolitische Themen. Von 2002 bis 2020 leitete er das Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement an der Landesverteidigungsakademie in Wien. Seine sicherheitspolitische Expertise teilt er mit Ministerien, Hochschulen und als Autor zahlreicher Beiträge zum Thema.